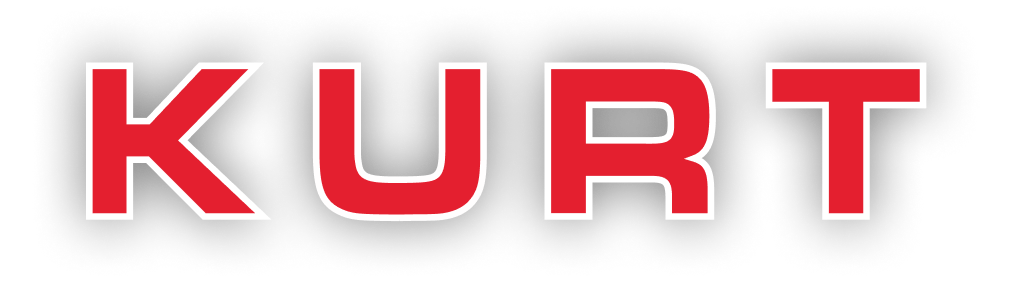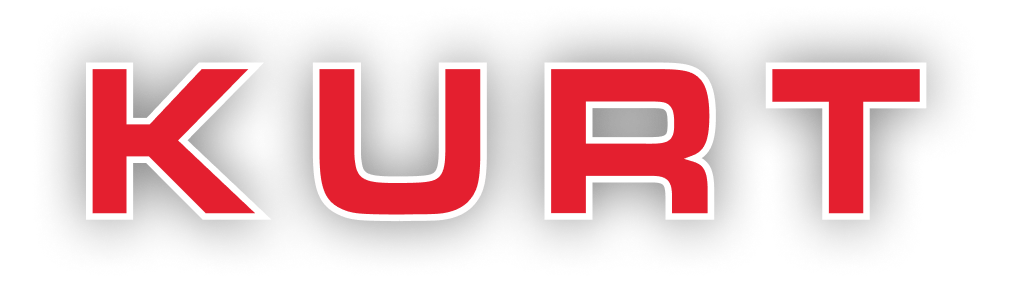Kunst
Affen, die nach dem Mond im Wasser greifen: Im Künstlerhaus Meinersen zeigt Ziming Peng ab 5. September seine tiefschürfende Videokunst
Malte Schönfeld Veröffentlicht am 30.08.2025
Er nennt den Ort: Faceless Town. In dieser Videoarbeit macht Künstler Ziming Peng den Protagonisten zum radikalen Beobachter.
Foto: Ziming Peng
Schlafwandeln wir in eine Diktatur der Technologie, in der Moral keine Rolle mehr spielt und der Vernunft die Lichter ausgeknipst werden? Ganz so schlimm ist es vermutlich noch nicht. In seinen Videoarbeiten erforscht der chinesische Stipendiat im Künstlerhaus Meinersen Ziming Peng die Grenzen von KI-Generatoren, die Echtheit von digitalen Erlebnissen und das Verhältnis von Technik und Benutzer. Seine Ausstellung „Mond im Wasser“ ist vom 5. bis zum 28. September dreimal pro Woche zu sehen.
Wie die Dinge sind, das können wir gar nicht wahrhaftig sagen. Das ist die These, die den Arbeiten von Ziming Peng, 1995 in der Provinz Hubei geboren, vorangestellt ist. Unsere Wahrheit speist sich aus physiologischen Mechanismen, technischen Medien und kulturellen Systemen – wie ein schwarztiefer See, in den gleich mehrere Flüsse münden.
Ein Jahr nach dem Einzug in das Künstlerhaus Meinersen als Stipendiat der Samtgemeinde und Gemeinde steht nun Ziming Pengs Ausstellung „Mond im Wasser“ bevor. Der Titel ist die vereinfachte Form eines chinesischen Sprichworts, das entzerrt „dem unerreichbaren Mondbild im Wasser nachzugreifen“ meint. Es entstammt einer Geschichte, bei der eine Horde Affen des Nachts versucht, den auf dem See gespiegelten Mond zu ergreifen, in dem sie sich in einer Kette vom Ast eines Baumes hangeln – bis sich das Wasser kräuselt, sie erschrecken und in den See fallen. Der Anspruch von Ziming Peng: „Ich möchte Themen unter der Oberfläche verstecken.“
„Lange Zeit habe ich mich gefragt, was meine künstlerische Sprache ist. Doch am Ende bezieht sich meine Arbeit immer auf das Bild„, erklärt Ziming Peng, Stipendiat im Künstlerhaus Meinersen.
<p class=“rights">Foto: Ziming Peng

Was wirklich ist und was nicht, das war lange Zeit höchstens durch die Mythologie und Religion herausgefordert. Das Korn auf dem Feld, das gefährliche Raubtier auf der Jagd, der Taler in der Hand – ästhetisch hatte alles einen Ursprung und eine Verankerung in der echten (und einzig bekannten) Welt. Doch mit dem Fortschritt der Technik bekam die Realität Konkurrenz, bis zu dem Punkt, an dem wir uns mittlerweile im globalen Wettstreit der Künstlichen Intelligenzen befinden und die Wirklichkeit vielleicht sogar alsbald Konkurs anmelden muss.
Drei Werke zeigt Ziming Peng in seiner Ausstellung. Zwei davon sind 3D-animierte und KI-generierte Videoarbeiten, die in seiner Meinerser Zeit entstanden sind.
In „Subscribe to Remove the Watermark: What Makes Us Alike or Different?“ seziert er kommerziell betriebene KI-Generatoren, indem er deren verborgene Logik in eine flackernde Choreographie aus Ladebalken, Pop-ups und Auto-Beautify-Schaltflächen übersetzt. Oberflächlich geht‘s dabei um algorithmusberechnete stereotype Physiognomien, denn die Models geben eben nur das wieder, was die Unternehmen im Training an Datenbanken bereitstellen.
„Subscribe to Remove the Watermark: What Makes Us Alike or Different?“ testet die Grenzen von Kreativität und entdeckt Spannungsfelder.
Foto: Ziming Peng

Tiefergehend spielt natürlich auch das Kapital eine Rolle. „Wir müssen bezahlen und abonnieren. Ohne Benefits entwickeln sich einzelne Generatoren nicht weiter“, erklärt Ziming Peng. Je mehr bezahlt wird, desto größer dürften auch die Datenmengen werden. Wie so häufig im Kapitalismus tendiert der vielgelobte Markt zur Monopolisierung – und digitale Wirklichkeit wird bestimmt von einigen wenigen, die sich das auch noch teuer bezahlen lassen. „Subscribe to Remove the Watermark“ ist auch eine Abhandlung über das Verhältnis von Ästhetik der Technologie und kognitiven Fähigkeiten der Benutzer – beide haben ihre Grenzen, doch nur eines scheint auf dem Rückzug zu sein.
In „Faceless Town“ vertieft sich Ziming Peng noch mehr in der Rolle des Beobachters, in der des „Außenseiters“. Wir sehen den Protagonisten in ein unbekanntes Tal treten, wo gesichtslose Menschen leben. Er nennt diesen Ort: Faceless Town. Während die Bewohner bleich bleiben, wandelt sich das Gesicht des Protagonisten immer wieder. Tatsächlich erneut eine technische Begrenzung der KI, wie Ziming Peng erklärt. Doch erst das wirft eine existenzialistische Frage auf: Wer ist leer, wer ist schon etwas? Denn nach Jean-Paul Sartre sieht es mit dem Menschen ja wie folgt aus: „Er wird erst dann, und er wird so sein, wie er sich geschaffen haben wird.“
Vom Beobachter, der dokumentiert anstatt einzugreifen, wechselt Ziming Peng in „The Killing Game“ (2023/24) das Tempo. Es ist seine Abschlussarbeit aus dem Studium der Bildenden Künste an der Kunsthochschule Kassel in der Klasse von Professor Bjørn Melhus und erzählt in essayistischer Form und in der Ästhetik von Shootern die Geschichte von zwei Spiele- Ziming Pengs Examen „The Killing Game“ ist eine 45-minütige Tour de Force, die Tötungsakt, Wiederauferstehung und die Zertrümmerung von Moral remixt.
Foto: Ziming Peng
charakteren, die in Fantasy- und Sci-Fi-Welten unterwegs sind. Gewalt, Moral und Werte – was sind sie virtuell, wenn man doch unsterblich ist? Es ist ein Szenario wie in der dystopischen HBO-Serie „Westworld“, was den Künstler reizt.

Für Ziming Peng bleibt die Endlichkeit des Lebens etwas, was Moralität erst möglich macht, auch wenn Techkonzerne mit Hochdruck daran coden, den Geist in eine Cloud zu laden. Klonkörper und Organfabriken, die sieht er zwar am Himmel aufziehen. Doch die notwendige Dualität aus Körper und Geist, die uns zu einzigartigen Subjekten macht, die sieht er so leicht nicht geknackt.
Die Affen und das Spiegelbild des Mondes, wie der Ausstellungstitel alles zusammenfasst – wir haben es mit Simulationen zu tun, die für uns täuschend echt wirken. In einer durch Medien dominierten Welt verlieren Abbilder den Bezug zu einem realen Ursprung, sie werden Hyperrealitäten, wie sie Jean Baudrillard in „Simulacres et Simulation“ (1981) beschrieben hat. Und ob uns dieses Sinnangebot ausreicht, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden.
Ausstellung von Ziming Peng:
„Mond im Wasser“
Künstlerhaus
Hauptstraße 2, Meinersen
Vernissage: 5. September, 19 Uhr
Ausstellung: 6. bis 28. September Do., Sa. & So. 15 bis 18 Uhr