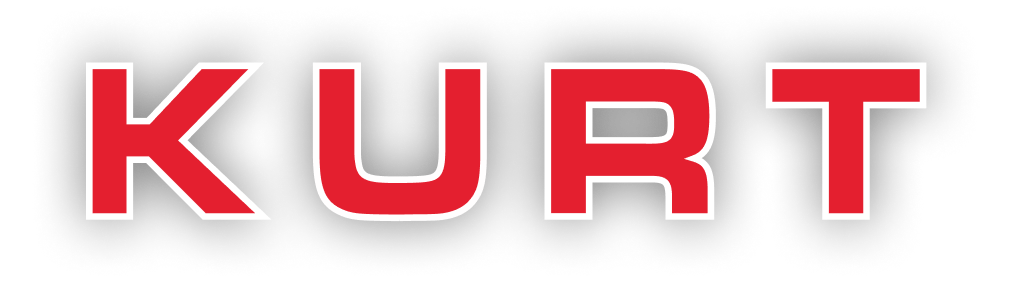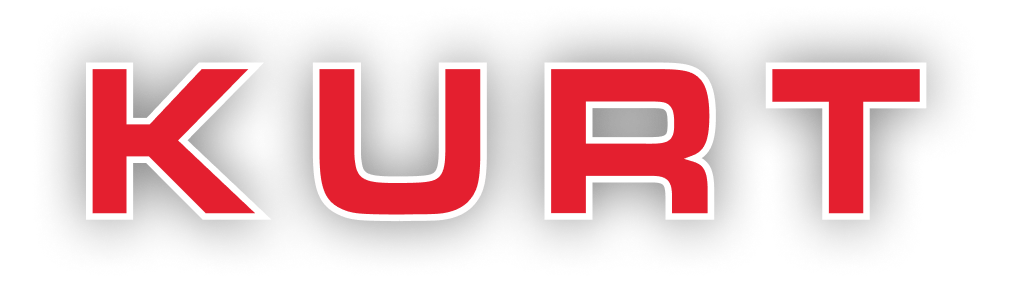Engagement (Anzeige)
Geschichten erzählen, bevor sie verblassen: 1. Gala für Gastarbeiterinnen steigt am 30. Oktober in der Stadthalle Gifhorn
Redaktion Veröffentlicht am 27.10.2025
Rukiye Cankiran (von links), Sevdeal Erkan-Cours und Mehtap Aydınoğlu rücken das Scheinwerferlicht auf die Gastarbeiterinnen, die auch in Gifhorn beim Wiederaufbau nach dem Krieg geholfen haben.
Foto: Privat
So wie jedes Land ist Deutschland geprägt von Biographien der Einwanderung, die Hoffnungen und Träume mit sich bringen, aber auch Brüche und Sorgen. Eine besondere Rolle kommt den Arbeitsmigrantinnen und Migranten zu, die ab 1955 als sogenannte Gastarbeiter aus Italien, Spanien, Griechenland, der Türkei, Marokko, Portugal, Südkorea, Tunesien und Jugoslawien nach Deutschland kamen, um das Land nach dem Krieg aufzubauen. Am 30. Oktober 1961 schloss Deutschland das Anwerbeabkommen mit der Türkei – genau 64 Jahre später gibt es nun in der Stadthalle die erste Gifhorner Gala zu Ehren der Gastarbeiterinnen. Die Organisatorinnen von Gerecht statt Geschlecht sorgen für ein emotionales Programm mit Musik, Gesang, Lesung und Comedy. Der Eintritt ist frei, 500 begehrte Plätze stehen zur Verfügung. KURT-Redaktionsleiter Malte Schönfeld sprach mit den Gleichstellungsbeauftragten Sevdeal Erkan-Cours aus Gifhorn, Rukiye Cankiran aus Papenteich und Mehtap Aydınoğlu, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, über Erinnerungen an deutsche Omas, die Bedeutung von Gastarbeiterinnen und ewige Zerrissenheitsgefühle.
Wie sind Eure Familien nach Deutschland gekommen?
Sevdeal: Zuerst kam meine Mutter 1972 aus der Türkei nach Deutschland, später folgte mein Vater. Meine ältere Schwester blieb erst noch in der Türkei, wo sie geboren wurde, also hat es gedauert, bis wir in Deutschland wieder vereint waren.
Meine Mutter war von Sorgen getrieben, weil ihr erstes Kind unterversorgt in der Türkei gestorben war. In Deutschland wollte sie Geld verdienen, damit das ihren nächsten Kindern nicht passiert. Es war ein Überlebenskampf. Noch in der Türkei wurde sie ärztlich untersucht, Zähne, Augen, Hände, sie war belastbar, bekam einen Arbeitsvertrag und durfte bei Blaupunkt in Hildesheim anfangen. Ursprünglich sollten ja die Gastarbeiter alle zwei Jahre ausgetauscht werden – wogegen die Konzernchefs nach dem mühsamen Einarbeiten protesierten. Später ging es für sie nach Gifhorn ins Teves-Werk, weshalb ich auch in Gifhorn aufgewachsen bin.
Kommt Dir das bekannt vor, Rukiye?
Rukiye: Ähnlich war es bei uns. Im März 1971 kam meine Mutter nach Hamburg, gerade frisch verheiratet worden, im Dezember wurde ich geboren. Die Idee, nach Deutschland zu kommen, war aus der Not geboren. Kein Geld, keine Zukunft, meine Mutter hatte zwölf Geschwister. Plan war es, nach zwei Jahren zurückzukehren, doch aus Gastarbeitern wurden Gastrentner, die nun Gasttote sind.
Von 5 bis 7 Uhr hat meine Mutter ihren ersten Job gehabt, als wir in der Schule waren den zweiten, abends dann den dritten. Sie war 40 Jahre Reinigungskraft. Und nebenbei noch Mutter. Aufgrund der schlecht bezahlten Teilzeitarbeit bekam sie später eine niedrige Rente.
Was ich traurig finde: Diese Generation hat ein Leben lang einen unerfüllten Traum gelebt. Das schönste Geschirr und die Elektrogeräte wurden in die Türkei geschickt, während man selbst zu Hause aus Billigbechern vom Flohmarkt getrunken hat.
Und bei Dir, Mehtap?
Mehtap: Als ich 2 Jahre alt war, 1965, sind meine Eltern mit mir nach Bayern gegangen. Mein Vater war kein klassischer Gastarbeiter, sondern Arzt. Meine Eltern waren noch sehr jung, meine Mutter 18. Das war nicht leicht für sie.
Ich wurde gut aufgenommen, und je schneller man die Sprache spricht, desto eher gehört man dazu. Mir wurde sogar verboten, mit Türken zu sprechen, damit ich die Sprache schneller lerne (lacht). Freunde zu finden, war trotzdem schwierig. Für andere Kinder war ich „der Schwarzkopf“, später in Nordrhein-Westfalen dann leider „die
Kakerlake“.
Rukiye: Mein Vater wurde „Kümmeltürke“ genannt. Ob ihm klar war, dass es dabei um mehr als das Gewürz geht, weiß ich nicht.
Also wurden Eure Eltern in Deutschland mit Skepsis empfangen?
Rukiye: Nein, herzlich wurden sie empfangen. Teilweise mit Musik und Essenspaketen vom Arbeitgeber. Nur hat sich dann mit der Zeit etwas entwickelt, was immer geschieht, wenn Fremde dazukommen: soziale Verteilungskämpfe.
Mehtap: Mein Vater sagte immer, es war sehr schön. Schnell haben meine Eltern eine Wohnung gefunden und mein Vater konnte als Lungenarzt in einem Sanatorium arbeiten. Viele Kinder wurden irgendwann aber zurück in die Türkei geschickt. Ich war leider eines davon. Und konnte auch kein Wort Türkisch. Das habe ich erst im Internat gelernt.
Sevdeal: Mittags haben deutsche Omas auf Kinder wie mich aufgepasst, als meine Eltern im Schichtdienst bei Teves gearbeitet hatten.
Doch es geht immer um Geld, Gerechtigkeit und ein besseres Leben. Später wurden Feindbilder geschürt und Sündenböcke gesucht. Uns wurde in der Schule gesagt: Wann geht Ihr zurück? Zuhause habe ich meine Mutter angeschaut: Wohin sollen wir gehen? Ich bin ja in Gifhorn geboren. Erst mit 12 Jahren habe ich das türkische Dorf meiner Eltern besucht. Meine Kinder fragen mich heute, ob wir Migrationshintergrund haben. Sie können selbst gar kein Türkisch mehr.
Mehtap, Du kennst beide Perspektiven: Biographie und Bürokratie. Warum ist Integration ein so verdammt schwieriger Prozess?
Mehtap: Integration hat mit Sprache zu tun. Hätte man den damaligen Gastarbeitern die Möglichkeit gegeben, die Sprache zu lernen, und mit der Sprache die Traditionen und die Religion, wäre es viel einfacher gewesen. Deswegen glaube ich, dass Kindertagesstätte und Schule so wichtig sind für den Sprachlernprozess.
Noch heute sehen wir: Menschen, die Englisch sprechen, und wenn es nur ein bisschen ist, sind schneller in der Gesellschaft eingeweiht. Man traut sich, den Nachbarn etwas zu fragen oder auf die Erzieherin im Kindergarten einzugehen.
Ihr organisiert die Gala der Gastarbeiterinnen auch, weil die Biographien von Frauen zu kurz kommen. Warum ist das so?
Sevdeal: Wir erzählen natürlich beides, Männer- und Frauengeschichten. Aber das Patriarchat ist daran Schuld, dass Frauen und ihre Geschichten verdrängt werden. Wenn man sich die Bilder von früher anschaut, sind es immer die Männer mit den Koffern und die gebückten Frauen mit den Kopftüchern, die nachgeholt wurden.
Dabei war es häufig andersherum, so wie bei unseren Müttern. Das waren Frauen, die mit Herzschmerz ihre Kinder in der Türkei gelassen haben, um Geld für die Familie zu besorgen. Später kamen die Männer nach.
Rukiye: Es ist typisch für europäische Frauen, sich besser zu fühlen als Frauen, die aus dem Orient kommen. Man darf auch nicht vergessen: Bis 1976 durften deutsche Frauen nur arbeiten, wenn der Mann ausdrücklich zugestimmt hatte. Dieses Phänomen sehen ganz viele nicht. Dagegen kam im ersten Schwung der türkischen Gastarbeiter ein Fünftel Frauen, viele davon Analphabeten. Da sieht man, wie verzweifelt und mutig sie waren, um im Leben voranzukommen.
Was trägt man in sich, was versteht man nur als Mensch mit Migrationsgeschichte?
Mehtap: Den Verlust der Heimat, die Sehnsucht danach. Ich bin mit zwei Herzen unterwegs, mit den Traditionen und der Religion aus der Türkei, aber auch mit Weihnachten, Ostern und Pfingsten für Deutschland. Und das ist etwas Schönes.
Sevdeal: Ja, das Zerrissenheitsgefühl. Zwischen zwei Welten zu sein und Brücken bauen zu müssen. Nie dazuzugehören. Und manche sind daran kaputt gegangen. Ich war als Sozialpädagogin in der Jugendberufshilfe tätig und weiß um die Schwierigkeit bei der Vermittlung in Ausbildungsplätze von Jugendlichen mit Namen wie Ali, Ayse und Murat.
Als ich meinen Studienplatz erhielt, war ich überglücklich, denn es war ein Zeichen dafür, wie weit wir es geschafft hatten. Es war keineswegs selbstverständlich, besonders in Anbetracht der Tatsache, dass Kinder aus Arbeiterfamilien viel seltener studieren als Kinder aus Akademikerhaushalten – heute noch.
Rukiye: Wir sind die Gestrandeten und Heimatlosen. Wir passen nicht nach Deutschland und nicht in die Türkei. Man ist immer die Fremde.
Sevdeal: Oft hatte ich das Gefühl, mehr leisten zu müssen, um wahrgenommen zu werden. Viele unserer Eltern kamen ohne Sprachkenntnisse und lebten mit der Unsicherheit, ob ihr Aufenthalt verlängert würde. Eine Belastung, die auch uns Kinder mitprägte. Heute stehe ich auf der Bühne und habe Angst, dass die Geschichte meiner Eltern verblasst.
Bei der Gala soll es Ausstellung, Musik, Gesang, Lesung und Comedy geben. Eigentlich ein mutmachendes Beispiel, wie Integration gelungen ist?
Sevdeal: Ganz genau. Das soll die Bühnenpräsenz zeigen. Unter anderem dürfen wir Daniela Cavallo begrüßen, worüber wir sehr glücklich sind. Sie ist ein italienisches Gastarbeiterkind und heute Betriebsratsvorsitzende bei Volkswagen. Das sagt doch viel aus!
Mehtap: Viele aus der migrantischen Community sagen: Endlich will jemand wissen, was mit meinen Eltern passiert ist. Einige haben schon an-
geboten, Fotos von früher zu schicken. Ich würde mich freuen, wenn viele Migranten sich im Thema der Gala wiederfinden. Und wenn die Deutschen erfahren, wie es uns ging. Denn darüber wird selten berichtet.
Rukiye: Um den Rahmen so würdevoll wie möglich zu gestalten, haben wir extra den Theatersaal ausgewählt. Viele Gastarbeiter sind anfangs in überfüllten Wohnheimen und Baracken untergekommen, manche waren ihr Leben lang in keinem Theater. Und wenn es nach uns geht, sollten wir diese Gala jährlich an einem anderen Tag eines Anwerbeabkommens wiederholen.
Ich erlebe, dass Menschen kaum etwas über die erste Generation der Gastarbeiter wissen. Und das muss sich ändern! Was für Musik haben die Gastarbeiter gehört, wie haben sie gelebt, was gefühlt – wir können alle voneinander noch so viel erfahren.
Gala der Gastarbeiterinnen
Donnerstag, 30. Oktober
Stadthalle Gifhorn
18 Uhr: Einlass
18.30 Uhr: Grußworte vom Ersten Kreisrat Dominik Meyer zu Schlochtern, Bürgermeister Matthias Nerlich und der VW-Betriebsratvorsitzenden Daniela Cavallo
Anschließend: Comedy mit Osman Engin, Musik von Aşır Özek und Saz/Bağlama (Langhalslaute) und dem Frauenchor Can Arkadaş, Lesung mit Rukiye Cankiran, Sevdeal Erkan-Cours, Mehtap Aydınoğlu und Fredericki Goulio sowie Ausstellung von İlhan İşözen