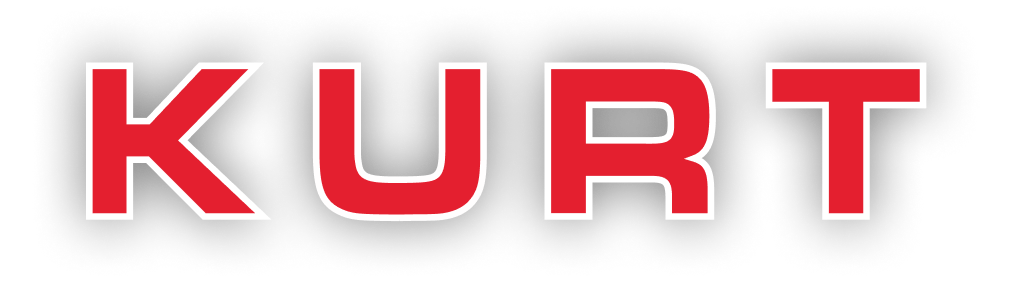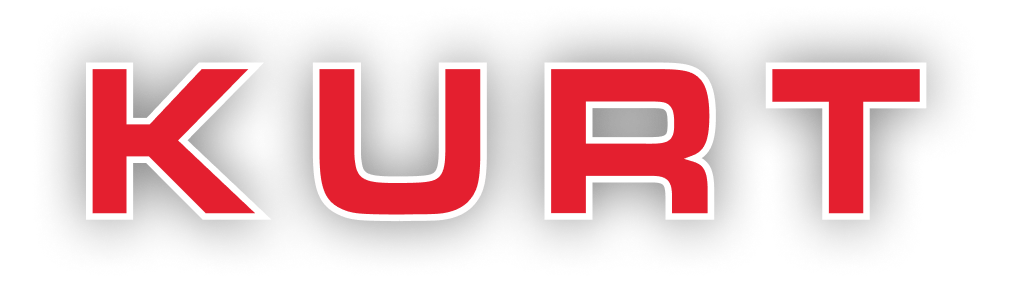Verantwortung
Opfer gedenken, Täter aufdecken: Historiker Dr. Steffen Meyer erzählt von seiner Arbeit in der Diakonie Kästorf, Missbrauchsfällen in der Evangelischen Kirche und dem Stolperstein-Projekt
Malte Schönfeld Veröffentlicht am 25.02.2024
Dr. Steffen Meyer ist Historiker in der Dachstiftung Diakonie. Die Aufarbeitung der NS-Gräuel an Bewohnern der Kästorfer Anstalten ist Teil seiner Arbeit. Auf diesem Foto spricht er zu den Gästen einer Stolperstein-Verlegung.
Foto: Mel Rangel
Seit mehreren Jahren berichtet KURT über die Verlegung von Stolpersteinen für Opfer der NS-Diktatur in Gifhorn und auf dem Gelände der Dachstiftung Diakonie in Kästorf. Bedeutende Arbeit leistet dabei Dr. Steffen Meyer (55) aus Gifhorn. Der Historiker arbeitet in der Historischen Kommunikation der Dachstiftung Diakonie und übernimmt Verantwortung beim Stolperstein-Projekt. Im Interview mit KURT-Redakteur Malte Schönfeld sprach er über den Beruf des Historikers, die neue Missbrauchsstudie der Evangelischen Kirche und Diakonie sowie die Wichtigkeit der Erinnerungskultur.
Archivar in der Diakonie, Teil des Stolperstein-Projekts, Experte für die Missbrauchsstudie der Evangelischen Kirche – was machst Du eigentlich genau als Historiker?
Hauptberuflich fing ich 2008 in der Diakonie Kästorf an, eine der beiden Gründungseinrichtungen der Dachstiftung Diakonie. Doch die ersten Berührungspunkte gab es schon 2002, als ich gerade mein Studium beendet hatte. Da wurden in alten Koffern Akten gefunden, die in einem schlechten Zustand waren. Diesen historisch wertvollen Bestand, es handelte sich um die Patientenakten der Trinkerheilstätte Stift Isenwald, sollte sich jemand anschauen. Der damalige Personalleiter in Kästorf knüpfte den Kontakt zu seiner alten Universität – er hatte selbst mal Geschichte in Braunschweig studiert, so wie ich. Und weil ich aus Gifhorn kam, passte das gut.
Anfangs habe ich als freischaffender Historiker Honoraraufträge übernommen. Dabei habe ich in die Akten aus der Jugendhilfe geschaut und bin auf Fälle von körperlichen Züchtigungen, sexualisierter Gewalt und Zwangssterilisation gestoßen. Die Patientenakten der Kästorfer Trinkerheilstätte Stift Isenwald, die von 1901 bis 1942 existierte, dienten mir als Grundlage für meine Promotion.
Dr. Jens Rannenberg vom Diakonievorstand, Künstler Gunter Demnig und Dr. Steffen Meyer bei einer Stolperstein-Verlegung.
Foto: Mel Rangel

Nach und nach habe ich so das Archiv und die Abteilung Historische Kommunikation aufgebaut. Vor einem Jahr fing Katharina Gries bei uns an, die ebenfalls Geschichte studiert hat und super unterstützt. Zudem führen wir gerade ein Dokumentenmanagementsystem in der Dachstiftung Diakonie ein, hier bin ich Projektleiter. Und dann gehöre ich noch zwei anderen Teams an: dem Compliance-Meldestellenteam, an das sich Mitarbeitende, Klienten und Kunden wenden können, wenn sie einen Regelverstoß beobachten. Und dem Präventions- und Beratungsteam zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, das Teil unseres Schutzkonzeptes ist.
Man sieht, mein Beruf ist sehr vielfältig.
Also hockst Du nicht nur über vergilbten Zetteln, Vermerken und Notizen, die teilweise schon mehr als 100 Jahre alt sind?
Nein. Mich erreichen ganz unterschiedliche Anfragen, etwa von ehemaligen Bewohnern, die viele Jahre, manchmal Jahrzehnte nachdem sie bei uns waren, noch eine wichtige Information benötigen. Es gibt auch interne Anfragen, wenn etwa Jubiläen anstehen oder Bauakten benötigt werden.
Nach dem Zusammenschluss der Diakonie Kästorf mit dem Stephansstift in Hannover hat sich auch mein Betätigungsfeld erweitert. Ein Beispiel ist die Heimerziehung in der DDR. Das Gelände und Gebäudeensemble des Jugendwerkhofs August Bebel in Burg in Sachsen-Anhalt kamen nach der Wende zum Stephansstift, die Geschichte des Ortes und der dort lebenden und arbeitenden Menschen fällt nun in meinen Zuständigkeitsbereich.
Viktoria Kin (links) und Fenja Passekel, zwei Jugendliche der Diakonie Kästorf, verlegen selbst einen Stolperstein.
Foto: Torge Bleicher

Wie entscheidest Du, was Relevanz hat?
Das ergibt sich durch die Dringlichkeit der Anliegen. Oberste Priorität haben die Anfragen von ehemaligen Bewohnern, die zum Teil schon recht alt sind, wenn sie sich das erste Mal bei uns melden. Archivunterlagen sind dann oft eine wichtige Quelle, ihnen bei der Rekonstruktion ihrer Lebenswelten zu helfen. Manche haben lange Heimkarrieren hinter sich, waren in mehr als zehn Einrichtungen und bringen verständlicherweise Details durcheinander. Viele hatten Anrecht auf eine Leistung aus dem Fonds Heimerziehung, also haben wir vermittelt und mit Anlaufstellen in ganz Deutschland kommuniziert.
Bei Betroffenen sexualisierter Gewalt gibt es im Bereich der für uns zuständigen Landeskirche Hannovers seit 2012 eine Anerkennungskommission, die freiwillige Einmalleistungen an Betroffene ausbezahlt. Mit der Kommission arbeiten wir ebenfalls eng zusammen. Im Janur wurde die ForuM-Studie über die systematischen Missbrauchsfälle in der Evangelischen Kirche und der Diakonie veröffentlicht. Was kannst Du uns darüber erzählen?
Die Evangelische Kirche Deutschland und Diakonie Deutschland haben 2020 eine Studie in Auftrag gegeben, die über Fälle sexualisierter Gewalt in protestantischen Institutionen aufklären sollte. Jahrelang wurden die Opfer nur als Einzelfälle betrachtet.
Mit diesen Behauptungen hat die Studie aufgeräumt – und das Ergebnis überrascht mich und meine Kolleginnen und Kollegen aus den Diakoniearchiven natürlich überhaupt nicht, weil wir schon seit Jahren mit Betroffenen sexualisierter Gewalt in Kontakt stehen und den bisherigen Forschungsstand gut überblicken. Bei uns meldeten sich ehemalige Heimkinder. Untersucht wurden jetzt aber in erster Linie die Begebenheiten in der verfassten Kirche. Ob pietistische, konservative Pfarrersfamilie aus den 50er Jahren oder reformpädagogische Pastorenfamilie aus den späten 60ern – Täter haben die Gottgläubigkeit der Kinder und Jugendlichen, die sich der Kirche anvertraut haben, perfide auf sich umgelenkt und missbraucht. Es wurde auch geschwiegen, Akten wurden nicht zur Verfügung gestellt, was die Studie aufgezeigt hat.
Hast Du die Forschung in der Studie unterstützen können?
Leider ist das Forschungsteam nicht direkt an die diakonischen Einrichtungen herangetreten. 2021 habe ich den Studienleiter Prof. Dr. Martin Wazlawik deswegen auf unsere Erkenntnisse und Bestände aufmerksam gemacht – zum Beispiel haben wir mehr als 1000 Personalakten in der Diakonie Kästorf schon vor 20 Jahren gescreent. Ich konnte zwar einen Betroffenen sexualisierter Gewalt als Interviewpartner an die Forschenden vermitteln, aber die Bestände hat niemand einsehen wollen.
Wer ist dieser Mann? Die Lazarus-Kirche auf dem Gelände der Diakonie: Die Ziegel kamen aus der Ziegelei, die Bänke wurden selbst gebaut, ebenso der Altar.
Foto: Archiv der Dachstiftung Diakonie
Mit dem Betroffenen, der zu einem Interview bereit war, telefoniere ich seit mehr als zehn Jahren regelmäßig. Er ist jetzt 80 Jahre alt und wurde Ende der 50er Jahre im Stephansstift von einem Hilfserzieher vergewaltigt, der schon lange tot ist. Nach dieser furchtbaren Tat ist ihm noch mehr Unglück widerfahren.

Ich bin ein bisschen sein Ohr in die Welt, da er allein lebt und keine Familie hat. Als er einmal eine Geldleistung bekam und die auf seine Grundsicherung angerechnet werden sollte, konnte das in einem Telefonat mit der sehr zugewandten Sachbearbeiterin abgewendet werden.
Dieser Herr, von dem ich gerade spreche, ist nach vielen Jahren des Schweigens offen mit seinem Schicksal umgegangen. Ich kenne aber auch jemanden, der sagte: „Ich bin bei Ihnen Opfer sexualisierter Gewalt geworden. Das war in den 60ern. Ich weiß nicht mehr, wie der Täter heißt.
Ich will kein Geld von Ihnen und auch nicht, dass Sie mich zu dieser Anerkennungskommission vermitteln. Mich interessiert aber folgendes: Wie gehen Sie mit dem Thema um? Arbeiten Sie das auf? Und was machen Sie heute mit den Kindern? An wen können sich Kinder in Ihren Einrichtungen wenden, wenn Gefahr droht?“
Nachdem ich ihm von unseren Schutzkonzepten berichtet hatte, bedankte er sich für das Telefonat und meinte nur: „Ich finde, Sie machen gute Arbeit“ – und legte auf.
Dieser Fall ist dann gar nicht mehr untersucht worden und spielt daher auch in der ForuM-Studie keine Rolle. Fälle wie diese muss es noch viele mehr geben.
Lass uns über das Stolpersteine-Projekt sprechen. Diese Stolpersteine werden für die Opfer von NS-Gewalt verlegt, um ihrer zu gedenken – auch in Gifhorn und auf dem Gelände der Diakonie in Kästorf. Wie ist es zu der Zusammenarbeit mit dem Künstler Gunter Demnig gekommen?
Die Verlegung von Stolpersteinen muss immer die jeweilige Stadtverwaltung genehmigen. Dr. Klaus Meister, damals noch Kulturamtsleiter, sprach mich an und fragte: „Ich habe Ihr Buch über die Zwangssterilisationen gelesen. Wären die Stolpersteine nicht auch etwas für die Diakonie Kästorf?“ Wir haben sofort zugesagt.
Daraufhin hat Klaus Meister eine Arbeitsgruppe gebildet, die bis heute aktiv ist: Der Gifhorner Historiker Prof. Manfred Grieger war von Anfang an dabei, Annette Redeker, die sich sehr um die historische Aufarbeitung in Gifhorn verdient gemacht hat, außerdem jemand aus dem Stadtrat, anfangs Willy Knerr, jetzt ist es Dustin Rösemann. Nicht zu vergessen Heike Klaus-Nelles aus dem Stadtarchiv und Martin Wrasmann vom Bündnis Bunt statt Braun. Inzwischen beteiligt sich auch die Landkreisverwaltung. Wir von der Diakonie sind ohne Pause dabei, weil wir mehr als 70 Betroffene haben, jeder Einzelne soll mit einem Stolperstein bedacht werden.
Wann steht denn die nächste Stolperstein-Verlegung an?
Im Februar 2025, der genaue Tag steht noch nicht fest. Nach zwei Jahren Pause wird sich die Stadt Gifhorn wieder mit eigenen Stolpersteinen beteiligen. Und Gunter Demnig konnte ich von der Idee begeistern, im Zuge der nächsten Verlegung einen Vortrag im Mehrgenerationenhaus im Georgshof zu halten.
Was unterscheidet das Stolperstein-Projekt von Deinen anderen Arbeiten? Wie gehst Du bei der Recherche vor?
Unser Vorstand findet das Projekt sehr wichtig und gibt mir Rückendeckung für die Recherchen. Das ist nötig, denn Einzelschicksale genau zu recherchieren dauert seine Zeit.
Wir schauen zuerst in unserem Archiv, ob es eine Klientenakte gibt, was schon einige Male zutraf. Von da aus nehmen wir die Spur auf und fragen in anderen Archiven und Behörden nach. Melderegistereinträge sind wichtig oder Unterlagen aus dem Bundesarchiv, weil etwa ehemalige Heimkinder nach ihrer Entlassung zur Wehrmacht eingezogen wurden.
Patienten der Kästorfer Trinkerheilstätte Stift Isenwald. Das Foto soll um circa 1910 aufgenommen worden sein.
Foto: Sammlung Archiv der Dachstiftung Diakonie

Was passiert, wenn sich Lücken auftun? Das sehen wir ja häufig in den Biographien der Bewohner der Arbeiterkolonie.
Genau. Aber diese Lücken verraten uns auch etwas darüber, wie diese Menschen gelebt haben. Sie haben auch nach der Zeit in der Kolonie oft auf der Straße gelebt, haben versucht irgendwo sesshaft zu werden, einen Beruf zu ergreifen. Dann hat das nicht geklappt, weil etwa Beziehungen in die Brüche gingen. Sie sind dann weitergezogen und haben oft keine Akteneinträge hinterlassen. Manche kamen im gesetzten Alter zurück in die Diakonie, was wir dann auch so schreiben.
Wir müssen auch über zwei Täter sprechen. Immer wieder taucht ja in den Biogrammen der Opfer der Name des Psychiaters Dr. Walter Gerson auf. Neben den nationalsozialistischen Erbgesundheitsgerichten war vor allem er für das Schicksal offenbar hunderter Menschen verantwortlich, indem er ihnen leichtfertig „angeborenen Schwachsinn“ oder ähnliches attestierte und die Zwangssterilisation empfahl.
Walter Gerson leitete ein Provinzialerziehungsheim in Göttingen. Das war eines der wenigen staatlichen Erziehungsheime in unserer Region – es galt oft als letzte Station. Die meisten Einrichtungen waren ja in kirchlicher Trägerschaft und wenn man dort gemerkt hat, dass man mit den Jugendlichen nicht mehr zurechtkam, hat man sie in das Provinzialerziehungsheim überstellt. Und der Leiter war der Landesmedizinalrat und Psychiater Dr. Walter Gerson.
Schon vor der NS-Zeit gehörte es zu seinen Aufgaben, in den einzelnen Erziehungseinrichtungen psychiatrische Untersuchungen durchzuführen. Das machte er also auch schon 1931 und 1932. Und zum Teil sind die Ergebnisse dieser Untersuchungen in den Akten der Jugendlichen, die später zwangssterilisiert wurden, enthalten.
Stimmt es, dass Walter Gerson selbst jüdischer Abstammung war? Das Diakonie-Archiv führt seltene Fotos aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Einige zeigen Bewohner der Kästorfer Anstalten bei der Arbeit. KURT hat die Fotos koloriert.
Foto: Archiv der Dachstiftung Diakonie, ADHK 790_1443/ADHK790_1427 (BY-NC-ND 4.0) / Kolorierung: KURT Media via Photoshop Neural Filters
Ja. Gerson hatte eine jüdische Mutter, die 1942 in Theresienstadt umgebracht wurde. Ich habe mich natürlich lange gefragt, wie er die national-
sozialistische Erbgesundheitspolitik bejahen konnte.

Was Gerson anfangs nicht ahnen konnte, ist, dass er 1938 seine Approbation verlieren würde. Er durfte also seine Arbeit nicht mehr ausüben. Später ist er in ein Arbeitslager gekommen, in dem er als Anstaltsarzt arbeiten durfte. Die Zeit des Nationalsozialismus hat er überlebt und anschließend wieder dieses Provinzialerziehungsheim geleitet. Und da er als Fachmann der Erziehungspädagogik galt, berief ihn die Uni Göttingen nach 1945 als Honorarprofessor.
Es liegen Dokumente von jungen Menschen vor, die zwangssterilisiert worden sind und sich in den 50er Jahren nach Erklärung suchend an ihn gewandt haben. Walter Gerson hat seine Entscheidungen immer verteidigt.
Ein weiterer Name, der immer wieder Erwähnung findet, ist Martin Müller. Wer war er?
Martin Müller war Vorsteher der Kästorfer Anstalten und anfangs ein überzeugter Nationalsozialist. Er stand da in guter Tradition zu vielen anderen evangelischen Einrichtungsleitern, die eine Abneigung gegen die Weimarer Republik hatten. Für sie war das alles zu liberal und marxistisch, das Individuum stand zu sehr im Vordergrund. Auch die Goldenen Zwanziger mit den Clubs und Bars passten ihnen nicht. Die evangelischen Einrichtungsleiter und die Innere Mission, der Vorläufer der heutigen Diakonie Deutschland, wünschten sich eine ordnende, starke Hand zurück – eher einen Kaiser als einen Führer.
Aber so, wie sich die Situation dann in der Zeit der Weltwirtschaftskrise 1932 darstellte – auch die Diakonie Kästorf kam in eine große finanzielle Krise –, klang das Angebot der Nationalsozialisten für Martin Müller vielversprechend. Die Nazis hatten argumentiert, dass sich mit den Arbeiterkolonien einiges ändern würde und die sogenannten „Halben Kräfte“, so hat man Bewohner genannt, die Alkoholiker waren oder als „arbeitsscheu“ galten, in staatliche Bewahranstalten kommen sollten. Müller fand das gut, er befürwortete ein Bewahrungsgesetz.
Das Bewahrungsgesetz besagte, dass Randgruppen der Gesellschaft, die vielfach als „Asoziale“ diskriminiert wurden, zwangsweise in geschlossenen Fürsorgeanstalten untergebracht und zu Arbeit angehalten werden.
Ja. Martin Müller wollte in seiner Arbeiterkolonie die haben, die ordentlich und gottgläubig sind und arbeiten wollen. Wenn die in ihrem Leben mal in Notlage kamen, fühlte er sich verantwortlich. Aber nicht für die vermeintlich Arbeitsunwilligen, die in seinen Augen auf Kosten anderer lebten.
Was die Trinkerheilstätte Stift Isenwald betrifft, hatte Müller gehofft, in der Zeit des Nationalsozialismus könne man rigoroser gegen den Alkoholismus vorgehen und hätte mehr Möglichkeiten, Kurabbrüche abzuwenden. Denn solange die Patienten, von denen einige sehr wohlhabend waren, nicht entmündigt waren, konnten sie die Heilstätte jederzeit verlassen. Das passte Müller nicht, der außerdem ein Befürworter des Sterilisationsgesetzes war.
Harte körperliche Arbeit war Alltag in der Kästorfer Arbeiterkolonie. Einige Bewohner wurden zwangssterilisiert, heute erinnern Stolpersteine an sie.
Foto: Foto: Archiv der Dachstiftung Diakonie, ADHK 790_1395 (BY-NC-ND 4.0) / Kolorierung: KURT Media via Photoshop Neural Filters

Vorhin hast Du von mehr als 70 Personen gesprochen, die auf dem Gelände der Diakonie Kästorf einen Stolperstein bekommen sollen. Ist überhaupt abzusehen, wie viele Menschen in den Kästorfer Anstalten unter den Nazis gelitten haben?
Wir haben noch etwa zehn Fälle, die wir prüfen müssen. Das sind Fälle, wo ich damals keine Unterlagen gefunden habe, als ich 2003 den Auftrag bekam, über die Zwangssterilisationen zu forschen. Menschen, bei denen sich die Spur verlief, die vor den Gerichtsverfahren aus freien Stücken die Anstalt verlassen hatten und nicht klar ist, wohin sie gingen.
An anderer Stelle hast Du durchscheinen lassen, Du würdest über den Landesmedizinalrat Dr. Walter Gerson gern ein Buch schreiben wollen. Ist das schon in Arbeit?
Nein, noch nicht. Das steht, sage ich mal, in dem Ordner „Unerledigt“.
Eine andere Idee ist, sich näher mit dem Gifhorner Gesundheitsamt zu beschäftigen. Als ich zu den Zwangssterilisationen der NS-Zeit geforscht habe, bin ich auf die Gifhorner Amtsärzte Dr. Erich Braemer und Dr. Bernhard Franke gestoßen.
Braemer hat Gifhorn 1934 in Richtung Berlin verlassen, blieb dort nach dem Krieg und wurde 1948 Leitender Magistratsdirektor der Abteilung für Gesundheitswesen. Nach der Teilung Berlins blieb er im Ostteil und arbeitete unter anderem als Amtsarzt. In der DDR wurde er mehrfach für seine Verdienste um das Berliner Gesundheitswesen ausgezeichnet, etwa 1958 als „Verdienter Arzt des Volkes“. Seine Zeit im Nationalsozialismus, aber das kennt man ja auch ein bisschen aus der DDR-Geschichte, spielte natürlich keine Rolle.
Dr. Bernhard Franke dagegen blieb in Gifhorn. Eine Entnazifizierungskammer hielt ihn 1947 für ungeeignet, das Gifhorner Gesundheitsamt zu leiten, wogegen Franke Berufung einlegte. Noch vor der Entscheidung nahm er sich das Leben. Hierzu ist noch wenig bekannt.
Es gibt auf jeden Fall sehr viele Täter und nicht nur zwei oder drei.
Ja, genau. Die Stolpersteine sind natürlich ein Projekt, um der Opfer zu gedenken. Aber wir müssen das immer in Bezug zu den Tätern und zum historischen Kontext setzen. Wichtig ist es auch, einen Zugang zu jungen Menschen zu finden. Themen könnten die Ausgrenzung von Randgruppen, Mitläufertum und Gruppendruck sein.
Im Zuge der Stolperstein-Verlegung habe ich sehr gute Erfahrungen bei uns an der Rischborn-Schule in Kästorf gemacht. Ich war wirklich beeindruckt, was die Schülerinnen und Schüler alles wissen und wie sie sich reflektiert haben. Sie sagten: „Wir sind Förderschüler, Ausgrenzung und Hänseleien kennen wir. Wir wissen auch, wie es ist, wenn sich jemand über einen lustig macht. Und dass das irgendwann auch schlimmer werden kann, halten wir gar nicht für abwegig.“ Ein guter Ansatz, um ins Gespräch zu kommen.
Du hast auch Angehörige von NS-Opfern kennenlernen dürfen. Wie sahen die Reaktionen aus?
Gut erinnere ich mich an Ulrich Raschkowski, der aus Gifhorn kommt und hier Lehrer war. Er trat nach der ersten Stolperstein-Verlegung an mich heran und wollte bei einer weiteren Verlegung eine Patenschaft für einen Stolperstein übernehmen. Und dann erzählte er mir von der Geschichte seines Onkels, Kurt Georg Vogt, der im Zuge der NS-Euthanasie-Maßnahmen 1941 als Epileptiker getötet wurde. Ulrich Raschkowski hat darüber ein Buch geschrieben, wir tauschen uns bis heute regelmäßig aus. Er hat 2022 bei der Stolperstein-Verlegung als Pate für Kurt Reinhardt dessen Lebensweg vorgestellt, was ich ganz toll fand.
Gibt es auch negative Resonanz?
Tatsächlich. Wir haben eine Enkelin ausfindig gemacht, die fand das nicht so gut, was wir mit den Stolpersteinen machen. Ihr Großvater war ein Bewohner der Arbeiterkolonie Kästorf, der zwangssterilisiert wurde. Und die Enkelin, die ihn nicht kennengelernt hatte, sagte: „Ich weiß von meinem Großvater nur, dass das ein gewalttätiger Mann war, der alle drangsaliert und geschlagen haben soll. Und für so einen wollen Sie einen Stolperstein verlegen? Ich werde selbstverständlich nicht kommen.“
Das haben wir natürlich respektiert. Ich habe aber auch gesagt: „Bitte respektieren Sie, dass wir ihn als Opfer der NS-Gewaltmaßnahmen betrachten und einen Stolperstein für ihn verlegen möchten“. So kam es dann auch, ohne ihr Beisein.
Es leben noch ungefähr 245.000 Holocaust-Überlebende auf der Welt. Bald sind die letzten Zeitzeugen gestorben. Gleichzeitig etabliert sich eine Neue Rechte in Deutschland, die sich wie die Nazis vor 90 Jahren durch Demokratiefeindlichkeit, Rassismus und Tötungsfantasien beschreiben lässt. Wie erklärst Du Dir die neue Begeisterung für Rechtsextreme und ihre Parteien? Ist Eure Arbeit, ist die Aufarbeitung der NS-Zeit, etwa vergebens gewesen?
Das würde ich nicht sagen. Aber ich würde auch nicht so weit gehen und behaupten, dass aus Geschichte zwangsläufig gelernt wird.
Die Anhäufung dessen, was alles mit „Krise“ umschrieben wird – Finanzkrise, Umweltkrise, Corona-Krise, Flüchtlingskrise –, ist derzeit schon enorm, hinzukommen die Kriege in der Ukraine und Israel, was bei vielen für Ängste, Unsicherheiten und Orientierungslosigkeit sorgt. Die Bundesregierung ist in wichtigen Fragen uneins, der Ton rau, einige trauen Politkern alles oder gar nichts zu, was wiederum zu Politikverdrossenheit führt. Die sozialen Medien und ihre ungefilterte Verteilung von Falschnachrichten, Hass und Hetze spielen ebenfalls eine Rolle. Populisten aus dem rechten Milieu gehen da nicht unklug vor und setzen die richtigen Trigger. Sie diskreditieren etablierte Parteien und Politik an sich, versprechen vermeintlich schnelle und einfache Lösungen, was bei Teilen der Bevölkerung ankommt.
Ein Schlag ins Gesicht der Opfer des Nationalsozialismus ist die unsägliche Diffamierung der Erinnerungs- und Gedenkarbeit als „Schuldkult“ oder die von Björn Höcke geforderte erinnerungspolitische Wende um 180 Grad und seine Aussage über das „Denkmal der Schande“ in Berlin.
Was meine Arbeit anbelangt, finde ich den vorhin schon skizzierten Ansatz lohnend. Die Zeit des Nationalsozialismus nicht nur von hinten zu denken, also über die furchtbaren Ereignisse in den Konzentrations- und Vernichtungslagern zu berichten, sondern von vorn, wo es mit rassistischer und antisemitischer Hetze anfing, mit Ausgrenzung von Andersdenkenden, die zu Verfolgung und Terror führte. Was waren die Motive der Täter und Mitläufer, wer hat partizipiert? Hier kann man lernen, wie aus einer instabilen Demokratie eine Diktatur werden kann.
Hilfe für Betroffene von sexualisierter Gewalt
Die zentrale Anlaufstelle Help bietet unabhängige Information für Betroffene von sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche und der Diakonie. Beratungen sind kostenfrei und anonym.