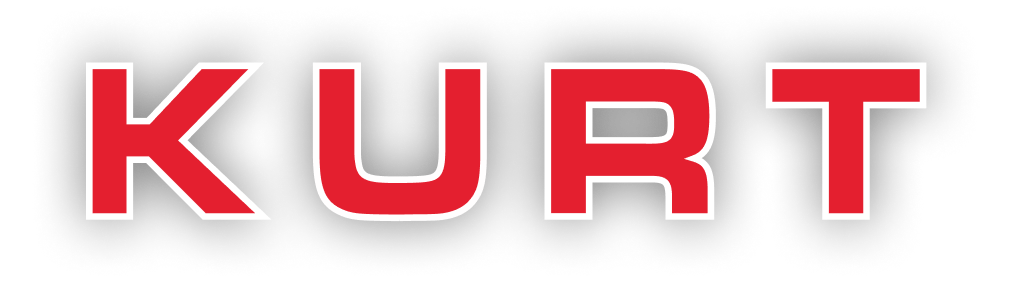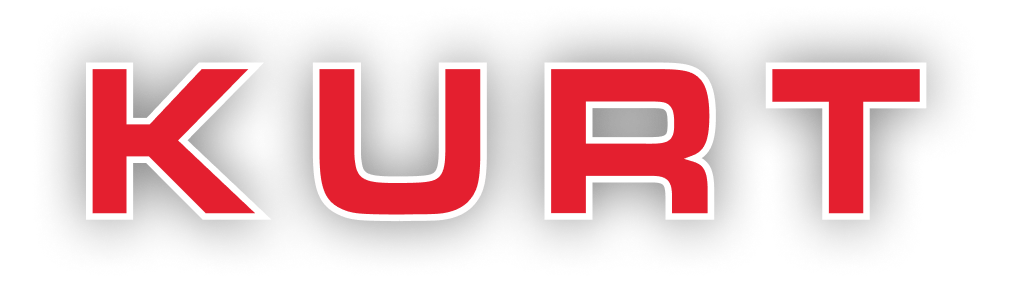Stolpersteine
Wenn aus der Dusche kein Wasser kommt: Einst lebte Werner Bolz in der Arbeiterkolonie in Kästorf, 1941 wurde er vergast
Katharina Gries Veröffentlicht am 02.11.2025
Dieser Stolperstein wurde für Werner Bolz auf dem Gelände der Kästorfer Diakonie verlegt.
Foto: Mel Rangel
Auf ihrem Kriegszug durch Europa und darüber hinaus töteten die Soldaten und Spezialeinheiten der Nationalsozialisten Millionen Menschen. Ihr Terror richtete sich jedoch auch nach innen, um die sogenannte Volksgemeinschaft rein und intakt zu halten. Unter dem Vorwand der „Rassenhygiene“ ermordeten die Nazis körperlich und geistig behinderte Menschen – so auch Werner Bolz, der als Wanderarbeiter 1930 erstmals in die Kästorfer Anstalten kam. Seine Geschichte schildert Katharina Gries aus der Historischen Kommunikation der Dachstiftung Diakonie in einem Gastbeitrag.
Werner Bolz wurde am 19. September 1900 als einziges Kind von Paula Bolz in Berlin geboren. Schon in seinem ersten Lebensjahr musste er wegen eines Katarakts am Auge operiert werden. Seine frühe Kindheit verbrachte er bei verschiedenen Pflegefamilien, bevor seine Mutter ihn im Alter von neun Jahren in einem Erziehungsheim in Quedlinburg unterbrachte, wo er auch zur Schule ging. Im Anschluss arbeitete er ein Jahr lang in einem landwirtschaftlichen Betrieb, bevor er eine dreijährige Gärtnerlehre absolvierte. Wegen seines damaligen Untergewichts wurde er während des Ersten Weltkrieges nicht zum Militär eingezogen.
Bevor Werner Bolz 1930 zum ersten Mal in die Arbeiterkolonie in Kästorf kam, arbeitete er in mehreren Gärtnereien und in der Landwirtschaft. In Kästorf blieb er mit kurzen Unterbrechungen, in denen er auf Wanderschaft ging, bis September 1935.
Am 27. September 1935 verließ Werner Bolz Kästorf nicht aus eigenem Wunsch: Er wurde aufgrund des Verdachts auf eine progressive Paralyse, die auf eine Gehirnentzündung im Jahr 1929 zurückgeführt wurde, in die Heil- und Pflegeanstalt Hildesheim überführt. Laut den Berichten des Psychiaters Dr. Walter Gerson und des Gifhorner Amtsarztes Dr. Bernhard Franke galt er als „Gefahr für seine Umgebung“.
Auch nach eigener Aussage litt Werner Bolz seit einiger Zeit an „Erregungszuständen“, die ihm schwer zusetzten. Um sie zu vermeiden, blieb er auch in der Heil- und Pflegeanstalt Hildesheim manchmal den ganzen Tag lang im Bett. In seiner Akte aus der Heil- und Pflegeanstalt wurde er jedoch als ruhig, freundlich und aufgeschlossen beschrieben, allerdings auch als aufdringlich, da er sich oft wünschte, nach Kästorf zurückkehren zu dürfen und um Ausgang bat. Werner Bolz, der zuvor als Wanderarbeiter viel unterwegs gewesen war, gefiel es in der Heil- und Pflegeanstalt Hildesheim, wo sich sein Leben in der ersten Zeit nur auf dem Anstaltsgelände abspielte, nicht. Sein Verhalten und sein Charakter wurden damals vom Klinikpersonal als Folge seiner Enzephalitis im Jahr 1929 verstanden.
Einen Lichtblick stellte für Werner Bolz der Gottesdienst der apostolischen Gemeinde dar, den er, selbst neu-apostolischen Glaubens, ab Ende 1936 besuchen durfte. Als Gärtner erledigte er in der Heil- und Pflegeanstalt auch kleine landwirtschaftliche Arbeiten und übernahm Haushaltsaufgaben auf seiner Station. Zudem tauschte er mit seinen Verwandten häufig Briefe aus, vor allem mit seiner Tante. Sein erstes Jahr in der Heil- und Pflegeanstalt verlief recht ruhig, doch Werner Bolz wünschte sich weiterhin, die Anstalt verlassen und nach Kästorf zurückkehren zu
dürfen.
Deshalb verfasste er im August 1936 einen Brief an Anstaltsvorsteher Pastor Martin Müller, in dem er darum bat, wieder in die Arbeiterkolonie aufgenommen zu werden. Dies wurde ihm jedoch nicht gestattet. Ende des Jahres verschlechterte sich zudem sein Gesundheitszustand. In seiner Akte wurden schwerfällige Sprache, Blickkrämpfe und Schwierigkeiten sich zu bewegen vermerkt.
Dieses Portraitfoto Werner Bolz zeigt den geborenen Berliner um das Jahr 1935.
Foto: Bundesarchiv Berlin, R 179/11549

Trotzdem nahm er ab dem Frühjahr 1937 die Gelegenheit wahr, endlich mit anderen Patienten ausgehen und Spaziergänge unternehmen zu dürfen, worüber er sich sehr freute. Als es im September jedoch zu einer Meinungsverschiedenheit kam, bei der Werner Bolz sich so sehr aufregte, dass er einen anderen Patienten schüttelte, wurden ihm der Ausgang und der Besuch des Gottesdienstes untersagt.
Werner Bolz ging weiterhin seinen Aufgaben auf der Station nach, wurde jedoch durch die Verbote unglücklich und bat vergebens darum, wieder den Gottesdient besuchen zu dürfen. Dieser Zustand verschlechterte sich in den kommenden Monaten noch. In seiner Akte wurde er im April 1938 als „interessenlos“ und „stumpf“ bezeichnet. Erst Ende Juni, als er wieder mit anderen Patienten ausgehen durfte, verbesserte sich sein Zustand erheblich: Er wurde wieder als dankbar, höflich und freundlich beschrieben.
Dann riss die Berichterstattung über Werner Bolz ab, bis es im Februar 1940 bei ihm vermehrt zu „Erregungszuständen“ kam. Werner Bolz schlug laut seiner Akte oft plötzlich um sich und wurde sehr ärgerlich, hatte aber meist im Nachhinein keine Erinnerung daran oder bereute sein Verhalten so stark, dass er nicht mehr aufstehen wollte. Im Oktober desselben Jahres verschlechterte sich erneut sein Gesundheitszustand. Er baute körperlich ab und hatte immer größere Schwierigkeiten, sich zu bewegen und zu sprechen. Aus dem letzten Eintrag in der Akte geht hervor, dass sich dieser Zustand bis zum Januar 1941 nicht verbesserte.
Am 14. März 1941 wurde Werner Bolz in die Landes-Heil- und Pflegeanstalt Waldheim verlegt. Hinter diesen und ähnlichen auf den ersten Blick unscheinbaren Einträgen in den Akten der Opfer der NS-„Euthanasie“ verbirgt sich der systematische Mord an rund 70.000 körperlich oder geistig behinderten Menschen in den Jahren 1940 und 1941. Später wurde er als „Aktion T4“ bekannt, benannt nach der Tiergartenstraße 4 in Berlin, wo sich die mit der Durchführung der Krankenmorde beauftrage Zentraldienststelle befand. Die NS-Ideologie der Eugenik sah vor, Leben, das als „lebensunwert“ verstanden wurde und „keinen Nutzen für die Volksgemeinschaft“ hatte, zu „vernichten“. Dies geschah unter anderem in Anstalten wie der ehemaligen Festung Pirna-Sonnenstein in Sachsen.
Bohnenernte in der Gärtnerei der Kästorfer Anstalten 1937. Da waren die Nazis bereits an der Macht.
Foto: Sammlung Archiv der Dachstiftung Diakonie / Kolorierung: KURT Media

Gemeinsam mit 102 anderen Patienten aus der Heil- und Pflegeanstalt Hildesheim wurde Werner Bolz am Morgen des 14. März 1941 in die Heil- und Pflegeanstalt Waldheim verlegt. Von dort aus wurden die Männer knapp zwei Monate später, am 12. Mai 1941, mit Bussen in die Anstalt Pirna-Sonnenstein gefahren und dort im Keller in einer als Dusche getarnten Gaskammer ermordet. Sehr wahrscheinlich kannten die Opfer den tatsächlichen Grund für ihre Verlegung bis zuletzt nicht. Um die Krankenmorde geheim zu halten, wurden die Opfer verbrannt und ohne Markierung auf dem Anstaltsgelände vergraben. Den Angehörigen wurden falsche Todesursachen mitgeteilt.
Auch der letzte Aktenvermerk „Mit Sammeltransport verlegt“ vom 12. Mai 1941 in Werner Bolz‘ Patientenakte diente der Vertuschung: Der Stempel sollte den Eindruck erwecken, dass die Patientenakte vollständig und abgeschlossen war, um Fragen nach dem Verbleib des Opfers vorzubeugen.
Offiziell wurde die „Aktion T4“ am 24. August 1941 beendet, doch die Ermordung von psychisch kranken und behinderten Menschen hörte damit nicht auf. Werner Bolz ist einer von fast 15.000 Menschen, die in Pirna-Sonnenstein im Zuge der NS-„Euthanasie“ ermordet wurden. Weshalb Werner Bolz für den Sammeltransport nach Pirna-Sonnenstein ausgewählt wurde, geht aus den erhaltenen Unterlagen nicht hervor. Angehörige sind nicht bekannt.
Dieser Text ist Teil der Broschüre „Stolpersteine in der Diakonie Kästorf“, kostenfrei erhältlich im Stadtarchiv, in der Stadtbücherei und bei der Diakonie in Kästorf.
Die Forschung zu Opfern des Nationalsozialismus geht weiter. Hinweise sammelt das Kulturbüro:
Tel. Tel. 05371-88226
kultur@stadt-gifhorn.de