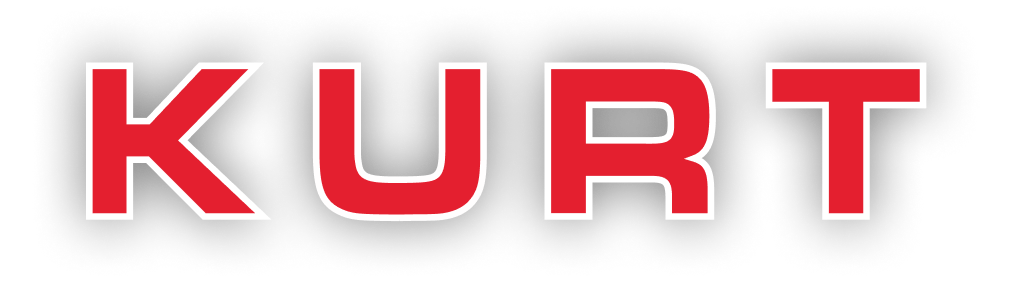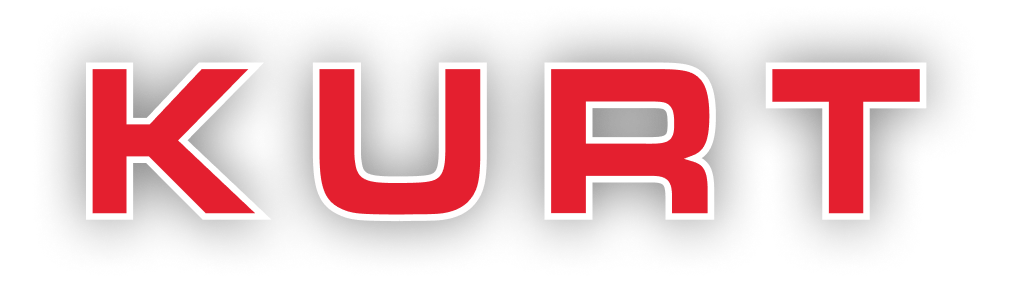Glück & Demut
Vom Glück, es zu finden, ohne gesucht zu haben – Der scheue Glanz, der flieht und sich entzieht, wenn man ihm zu sehr nachjagt
Bastian Till Nowak Veröffentlicht am 26.12.2025
Was als Glück empfunden wird, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich – und je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr erkennen wir, dass dem Glück mit Feuereifer nachzujagen oft nur auf den Holzweg führt.
Foto: Freepik
Zur Gala zur Verleihung des Gifhorner Hutes gehört immer auch ein Festvortrag. Anlässlich der Auszeichnung von Ingrid Pahlmann hielt ihn in diesem Jahr KURT-Herausgeber Bastian Till Nowak. Anders als die Vortragenden der Vorjahre ist er kein Wissenschaftler, Philosoph oder Akademiker. Er stammt aus einem Arbeiterhaushalt. Das Abitur hat er seinerzeit – nun ja – mehr so mit Ach und Krach geschafft, vielleicht auch mit etwas zu viel Charme und ein paar zu freundlichen Lehrern. Ein abgeschlossenes Studium hat er nicht. Was er jedoch nie aufgegeben hat, ist das Beobachten, das Fragen, das Staunen. Sein Vortrag war darum keine wissenschaftliche Abhandlung, eher eine Collage: eine Sammlung von Gedanken, Entdeckungen und Momenten, die sich im Laufe der Zeit bei ihm eingefunden haben – wie Fundstücke am Wegesrand. Eine Einladung, Glück nicht zu definieren, sondern es wiederzuerkennen.
Der Glücksbegriff begegnet uns nahezu täglich. Wir reden von Glückssträhnen im Fußball oder am Roulettetisch, wir verschenken Glücksschweine aus Marzipan oder vierblättrige Kleeblätter – und erfolgreiche Menschen nennen wir auch schon mal einen Glückspilz.
Sprichwörter wie „Das Glück ist mit den Tüchtigen“ oder „Jeder ist seines Glückes Schmied“ suggerieren uns, dass wir uns nur noch mehr anstrengen sollten – dann würde sich das Glück schon ganz von allein einstellen.
Und der Bergmannsgruß „Glückauf“ beschreibt lediglich den Wunsch eines Kumpels an den anderen, nach der Schicht wieder ans Tageslicht zurückzukehren – und nicht für immer unter Tage zu bleiben.
So unterschiedlich diese Beispiele sind – sie alle sprechen von Glück, aber keines erklärt es.
Also: Was ist denn nun eigentlich wirklich Glück?
Wenn wir Menschen befragen, was Glück für sie bedeutet, bekommen wir ganz unterschiedliche Antworten.
Spirituelle Menschen sprechen gerne vom transzendenten Glück: „Wenn ich Gott spüre.“ Oder: „Wenn ich das Gefühl habe, Teil von etwas Größerem zu sein.“
Andere wiederum suchen das Glück in sich selbst und sagen: „Wenn ich mit mir im Reinen bin.“ Oder: „Wenn ich Frieden finde.“
Erfolgsorientierte Menschen sehen hingegen eher ein vermeintlich messbares Glück und sagen: „Wenn ich genug Geld habe, um sorgenfrei zu leben.“ Oder: „Wenn andere sehen, was ich geschafft habe.“ Für sie bedeutet Glück vor allem auch Anerkennung.
Und dann gibt es die Skeptiker, die das Thema lieber mit einem Augenzwinkern nehmen: „Glück ist, wenn der Bus genau dann kommt, wenn ich selbst an der Haltestelle ankomme.“ Oder: „Glück ist, wenn der Chef Urlaub hat.“
Die meisten Menschen in diesen Befragungen sehen jedoch das Zwischenmenschliche. Sie sagen: „Glück ist, wenn mich jemand liebt.“ – „Wenn ich gebraucht werde.“ – „Wenn mein Kind lacht.“ Oder: „Wenn jemand ehrlich danke sagt.“ Sie sehen Glück als Resonanz: das Gefühl, gesehen, verstanden, verbunden zu sein.
Wiederum andere finden vor allem ihr Glück im Kleinen und Greifbaren. Sie sagen: „Glück ist ein Dach über dem Kopf und genug zu essen.“ Oder einfach nur „gesund zu sein“. Oder: „Wenn die Sonne scheint.“
Ähnlich leichtfüßig äußerte sich einst auch der 2005 verstorbene Entertainer Harald Juhnke, als er nach seiner Definition von Glück gefragt wurde. Da sagte er nämlich: „Keine Termine und leicht einen sitzen haben.“
Nun werden Sie sich wahrscheinlich gleich mit einer Vielzahl dieser Aussagen verbunden fühlen. Und das ist auch goldrichtig so – denn niemand von uns ist ausschließlich gläubig oder romantisch, in sich gekehrt oder erfolgreich. Das alles sind ja auch keine Gegensätze, es sind bloß verschiedene Fokusse.
All diese Antworten haben aber eines gemein: Sie sind nur Spiegelungen. Sie zeigen, wo wir suchen – aber nicht, was wir da eigentlich sehen. Dazu aber später mehr.
Glück lässt sich erforschen
Seit einigen Jahrzehnten hat sich die Glücksforschung etabliert. Und hier gilt erst mal: Um Glück zu messen, muss Glück definiert werden.
Dabei wird zwischen Zufallsglück und Lebensglück unterschieden. Zwar hat das Zufallsglück auch einen Einfluss auf das Lebensglück, aber es steht nicht im Zentrum der Glücksforschung.
Glück in diesem Sinne kann also als das Ziel und der Sinn des Lebens bezeichnet werden, weil letztlich alle anderen Ziele nur auf das eigene Glück oder das Glück anderer – und damit wiederum auf das eigene Glück – hinauslaufen. Die Abwesenheit von Leid und Mangel ist dabei das eine, das schöne Leben das andere.
Der Soziologe Gerhard Schulze, der auch den Begriff „Erlebnisgesellschaft“ prägte, unterscheidet diese beiden Arten in „Glück 1“ und „Glück 2“.
Die erste Variante des Glücks ist also nur die Vorstufe: die Freiheit von Leid und Mangel; oder auch das sorgenfreie Leben. Diese Vorstufe ist erst die Möglichkeit zum Erlangen des wahren Glücks, da sich ihm zufolge nämlich die Frage ergibt: „Wofür lebt man, wenn nicht für das schöne Leben?“
Wie können wir Glück messen?
Der Definition von Glück folgt nun die Messung. Und da stehen wir wieder vor einem Problem – denn wie soll man Glück messen?
Die Beobachtung allein ist dafür gänzlich ungeeignet, da die Einschätzung des Glücks anderer Menschen nicht unabhängig von der eigenen Stimmung ist.
Probieren Sie es einfach mal selbst: Versuchen Sie wirklich objektiv einzuschätzen, wie glücklich Ihr Gegenüber ist – und Sie werden merken, dass Ihr eigener Glückszustand das Ergebnis maßgeblich verfälscht. Klappt also nicht.
Wie wäre es dann also mit klaren Maßstäben, mit definierten Rahmenbedingungen? Also das sogenannte Ableiten des Glückszustands eines Menschen aus seinen objektiven Lebensbedingungen.
Doch auch das führt leider zu keinen brauchbaren Ergebnissen. Zwei verschiedene Menschen können nämlich theoretisch aus exakt denselben Bedingungen vollkommen unterschiedliche Schlüsse ziehen: Der eine ist glücklich, der andere ist unglücklich.
Und vor allem: Welche Maßstäbe, welche vergleichbaren Rahmenbedingungen sollten wir da schon ansetzen?
Gesundheit? Nein, da wissen wir ja, dass ab einem gewissen Alter eigentlich immer irgendetwas ist, worüber man sich beklagen könnte. Die einen sind trotzdem glücklich, die anderen unglücklich.
Wie wäre es dann mit einem größeren Begriff, etwas vielleicht noch Wichtigerem als alles andere: Freiheit zum Beispiel.
Klappt aber auch leider nicht. Freiheit wissen nämlich meist eh nur diejenigen zu schätzen, die in wirklicher Unfreiheit leben.
Warum auch Wohlstand kein verlässlicher Glücksmesser ist
Das mag vielleicht naheliegen, Wohlstand allein ist aber leider auch kein ausreichender Indikator für den Glückszustand. Denn wie zufrieden ich mit meinen materiellen Verhältnissen bin, ist vor allem eine Frage der individuellen Wahrnehmung. Es hängt also nicht so sehr davon ab, was ich mir absolut leisten kann, sondern davon, was ich mir relativ gesehen leisten kann.
Ein kleines Beispiel: Da kauft sich jemand ein neues Auto und ist sehr zufrieden damit – so ein richtig schicker Oberklassewagen. Der Mensch würde sogar so weit gehen und sagen, dass er jetzt glücklich ist. Auf die Dauer, wie lange dieses Glück anhält, hat er aber leider keinen Einfluss – denn das Glück hört genau in dem Moment auf, bis der blöde Nachbar in seiner Hofeinfahrt plötzlich das neuere Modell stehen hat.
Die einfachste Methode: Fragen wir die Menschen selbst, wie glücklich sie sind
Uns bleibt als Methode zur Messung also nur noch die Befragung. Dabei geht es nicht darum, ob das angegebene Glück objektiv gerechtfertigt ist. Es geht einzig und allein um subjektives Wohlbefinden – was aber in seiner Summe sehr viel aussagen kann über eine Gesellschaft.
Wichtig ist den Glücksforschern erst mal nicht, wie ausführlich eine Befragung ist, sondern ob sie vergleichbar ist. Fragen nach dem Glück müssen nämlich bezüglich Zeit und Kontext spezifiziert werden, damit vergleichbare Antworten erzeugt werden.
Die kürzeste und einfachste Form dieser Befragung lautet: „Alles in allem, wie würden Sie Ihren Zustand in letzter Zeit beschreiben – Würden Sie sagen, dass Sie a) sehr glücklich, b) ziemlich glücklich, oder c) nicht so glücklich sind?“
Das ist – zugegeben – etwas platt, aber es führt schon zu vergleichbaren Ergebnissen.
Schon mal vom Weltglücksbericht der Vereinten Nationen gehört?
Dass Befragungen vergleichbarer werden, wenn sie ausführlicher sind, beweist der Weltglücksbericht. Jahr für Jahr wird dieser von den Vereinten Nationen veröffentlicht und erfährt stets ein großes mediales Echo.
Darin wird nicht nur die allgemeine Lebenszufriedenheit auf einer Skala zwischen 0 und 10 abgefragt, sondern es fließen auch andere Kriterien in die Bewertung ein. Zentrale abgefragte Faktoren sind hierbei:
• Soziale Unterstützung: Die Umfrageteilnehmer geben an, wie wahrscheinlich es aus ihrer Sicht ist, dass Menschen in Not auf die Hilfe von Freunden, Familie oder anderen zählen können.
• Physische und psychische Gesundheit der Bevölkerung.
• Gesetzliche Freiheit: die Freiheit der Menschen, Entscheidungen in ihrem Leben selbst zu treffen.
• Das Maß an Großzügigkeit innerhalb einer Gesellschaft.
• Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf.
• Und es geht um den Grad der wahrgenommenen Korruption in Politik und Wirtschaft.
Finnland, Dänemark und Island lagen bei diesem Weltglücksbericht zuletzt auf den ersten drei Plätzen. Der finnische Gesamtglücksindex: 7,804 von 10. Deutschland lag mit 6,892 auf Platz 16.
Das kleine Himalaya-Königreich Bhutan macht es uns vor
Es geht aber auch noch sehr viel umfangreicher. Das kleine Königreich Bhutan zum Beispiel zählt 777.000 Einwohner und liegt hoch oben im Himalaya. Es führte Mitte der 2000er als erstes Land auf der Welt neben dem Bruttonationaleinkommen, bis 1999 auch bekannt als Bruttosozialprodukt, das sogenannte Bruttonationalglück ein.
Das soll den Lebensstandard in Bhutan in humanistischer und psychologischer Weise definieren und dem herkömmlichen, quantitativen Bruttonationaleinkommen einen ganzheitlicheren Bezugsrahmen gegenüberstellen. Also ein Versuch, den Lebensstandard nicht nur wirtschaftlich, sondern menschlich zu definieren. Nicht durch Geldflüsse, sondern durch Wohlbefinden.
Alle paar Jahre wird ein Teil der Bevölkerung ausführlich befragt – die Beantwortung des Fragebogens dauert um die 6 Stunden, weshalb ich an dieser Stelle auch darauf verzichten möchte, die einzelnen Kriterien zu benennen.
Nur so viel: Es geht neben dem psychischen Wohlbefinden mit den Indikatoren Lebenszufriedenheit, positiven und negativen Emotionen sowie Spiritualität auch um Gesundheit – körperliche wie auch mentale –, die Zeitnutzung (Arbeit, Freizeit und Schlaf), Bildung, Wissen und Werte, kulturelle Vielfalt und Resilienz, die Verwendung von Sprache und kunsthandwerklichen Fähigkeiten, Partizipation und politische Freiheit, die Lebendigkeit der Gemeinschaft mit sozialer Unterstützung, das Verhältnis zur Gemeinschaft, Familie und zu Opfern von Kriminalität, um ökologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Kapital, Unterkunft und Pro-Kopf-Einkommen des Haushalts und vieles, vieles mehr.
Es geht also um fast alles, was das Mensch-Sein betrifft – von der seelischen Gesundheit bis zur Zeitnutzung, von Bildung über Kultur bis hin zur Luft, die man atmet.
Wäre das Bruttonationalglück nicht auch etwas für uns?
Nun brauchen wir unser Leben in Deutschland natürlich nicht mit dem in Bhutan zu vergleichen. Beispielsweise gibt es dort auch Unterdrückung von Teilen der Bevölkerung und große Korruption – doch seit Einführung des Bruttonationalglücks sind die Glückswerte trotz politischer Spannungen nachweislich in vielen Bevölkerungsschichten nach und nach gestiegen, weil man politische Veränderungen aus den Ergebnissen der jeweiligen Befragungen abgeleitet hat.
Dass wir unser Leben nicht mit dem in Bhutan zu vergleichen brauchen, ist einerseits schön – aber andererseits auch bedauerlich, weil wir es nämlich gar nicht können. Denn außer in Bhutan wird nirgends auf der Welt ein so umfangreicher Glücksindex erhoben.
Jedoch findet hier und da auch ein bisschen Umdenken statt: Island, Neuseeland, Schottland und Wales haben sich bereits dafür entschieden, sich am Beispiel von Bhutan orientieren zu wollen und ihrerseits auch ein sogenanntes Bruttonationalglück zum Leitfaden ihrer Politik werden zu lassen.
Zurück zur Frage nach dem Glück
Noch mal zurück zur Glücksforschung: Einerseits gibt es da die Philosophische Glücksforschung. Das geht über die Jahrtausende. Von Aristoteles stammt die älteste überlieferte formale Definition des Glücks: Glück sei das, was der Mensch um seiner selbst willen anstrebt, und nicht, um etwas anderes damit zu erreichen.
Epikur hingegen definierte das Glück anders als Aristoteles nicht positiv, sondern negativ als Abwesenheit von Schmerz und Bedürfnissen. Die Medizin glaubt ja heute noch, dass es genügt, Menschen zu heilen, um sie glücklich zu machen.
Dann kam Seneca und vervollständigte die Definition der Stoiker: Glück sei ein natürlicher Zustand und werde lediglich durch Einflüsse von außen gestört. Wer also die sprichwörtliche stoische Ruhe an den Tag legt, macht sich unempfindlich gegen diese Einflüsse.
Was uns die Durchblutung unseres Gehirns verrät
In der Physiologischen Glücksforschung hat man zudem mittels Funktioneller Magnetresonanztomographie (MRT) und Elektroenzephalographie (EEG) herausgefunden, dass man Glück auch dank der Durchblutung bestimmter Hirnareale messen kann: So hat sich gezeigt, dass eine höhere Aktivität des linken präfrontalen Kortex stark mit einer offenen, neugierigen Haltung gegenüber Reizen korreliert, während eine höhere Aktivität des rechten mit einer eher ängstlichen Rückzugshaltung einhergeht.
In weiteren Experimenten konnte dann eine entsprechende Verbindung zwischen Hirnaktivität und persönlicher Einschätzung des Glücks zeigen: Stärkere Aktivität des linken präfrontalen Kortex trat deutlich häufiger mit höherer subjektiver Zufriedenheit auf.
Außerdem gibt es die Psychologische Glücksforschung und die Sozialwissenschaftliche Glücksforschung, über die ich an dieser Stelle aber gänzlich hinweggehen möchte.
Wenn das Streben nach Glück in der Hedonistischen Tretmühle endet
Wirklich spannend wird es auch in der Ökonomischen Glücksforschung. Denn unter dem Titel „Happiness Economics“ – das klingt schon so fröhlich, wie es ist – hat sich sogar die Wirtschaftsforschung der Glücksproblematik angenommen.
Man entdeckte, dass das Streben nach Glück eine wirtschaftliche Triebkraft ist. Die Kehrseite dieses glücklichen Konsums ist jedoch der Stress, mit dem das dazu nötige Geld erarbeitet werden muss.
So fand man heraus, dass mehr Wohlstand beziehungsweise mehr Einkommen die Menschen nicht in erwarteter Weise glücklicher macht. Es ist eben ein ewiges Hamsterrad – auch bekannt als Hedonistische Tretmühle.
Eine Studie ergab sogar, dass Lotto-Gewinner im Durchschnitt nicht glücklicher sind als Menschen, die nicht in der Lotterie gewonnen haben. Des Weiteren sind die Lotteriegewinner aber auch nur ein ganz kleines bisschen und kaum messbar glücklicher als Menschen, die durch einen Unfall gelähmt wurden.
Es bestätigt sich wieder: Glück kann man nicht kaufen!
Wie entkommen wir aber diesem Hamsterrad?
Der Philosoph Epikur und die moderne Work-Life-Balance
Viele Ökonomen, die sich damit beschäftigt haben, sagen, dass wir den Zwang nach dem Mehr abkoppeln müssen von einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Leistung und Genuss – besser bekannt als Work-Life-Balance.
Für jeden persönlich erst mal völlig nachvollziehbar, in der gesellschaftlichen Dimension wird es aber schwierig.
Der griechische Philosoph Epikur lehrte nämlich: „Wir brauchen immer dann eine Freude, wenn sie fehlt und wir darob leiden. Wenn wir aber nicht leiden, bedürfen wir ihrer nicht.“
Also hat man sich im modernen Marketing überlegt, durch das Wecken von Bedürfnissen ein Leiden zu schaffen, weil man – Epikur folgend – glaubt, glücklichen Menschen nichts verkaufen zu können.
Hinzu kommt – wir erinnern uns an das neue Auto vom blöden Nachbarn – der Neid auf materielle Dinge.
Der britische Nationalökonom Richard Layard, seit dem Jahr 2000 Peer im House of Lords, untersuchte die persönliche Zufriedenheit in Abhängigkeit vom materiellen Reichtum und vom Zeit-Reichtum der umgebenden Personen.
Die Teilnehmer seiner Studie fühlten sich deutlich weniger zufrieden, wenn die Umwelt in materiellen Dingen reicher war, während sie jedoch fast keinen Neid auf Zeitwohlstand – beispielsweise längeren Urlaub – zeigten.
Er schloss daraus, dass eine aufs Gemeinwohl ausgerichtete Politik mit einer starken Steuerprogression den Anreiz beseitigen sollte, durch Mehrarbeit mehr materiellen Reichtum anzuhäufen.
Da aber die persönliche Belastung durch Steuern von den meisten Menschen stärker wahrgenommen wird als die Vorteile der Umverteilung beziehungsweise die positiv lenkenden Effekte hin zu reduzierter Erwerbsarbeit, ist die erste Reaktion der meisten Menschen gegenüber höheren Steuern: ablehnend.
Und dann erinnern wir uns doch jetzt einfach noch mal an den Weltglücksbericht und an die Länder, die ganz vorne liegen: Finnland, Dänemark und Island. Und dreimal dürfen Sie raten, wo die Höchststeuersätze besonders hoch sind.
Das krasseste Gut, mit dem Handel getrieben wird
Doch zurück zum Glück. Auch wenn man das nicht kaufen kann, so gibt es doch eine ganz ähnliche Sache, die sich erwerben lässt. Es ist das vielleicht abgefahrenste Gut im Wirtschaftskreislauf – und nur die Lotteriegesellschaften dürfen damit Handel betreiben. Sie verkaufen etwas, das sogar größer ist als Glück. Sie verkaufen: Träume.
Denn nehmen wir mal an, wir kaufen uns am Mittwoch ein Lotterielos, dann haben wir bis zum Samstagabend Zeit, unsere mit dem Los gekauften Träume voll und ganz auszukosten.
Wir überlegen uns, was wir bei sechs Richtigen mit all dem schönen Schotter bloß anfangen würden. Wir schwelgen in Träumen, die sich niemals so greifbar und nahezu real zeigen würden, wenn wir nicht den Lottoschein in der Tasche hätten.
Und dann kommt die Ziehung der Lottozahlen – und selbstverständlich haben wir nicht gewonnen; und gehen nächste Woche wieder los, um uns ein neues Los zu kaufen. Denn das Glück der Träume hält ja nur so lange an, wie sie nicht zerplatzen.
Mit dem neuen Los kaufen wir uns aber wieder neue Träume. Und so können wir uns über Jahrzehnte einen glücksähnlichen Zustand erkaufen. Schon ziemlich bewundernswert, zu welchen Selbsttäuschungen der Mensch fähig ist.
Warum wir uns auch freuen können, wenn wir nicht gewinnen
Allerdings – so haben wir ja bereits erfahren – sind Lottogewinner ja kaum glücklicher als Menschen ohne Lotteriegewinn. Also sollten wir vielleicht sogar glücklich darüber sein, nicht zu gewinnen: Jawoll, wieder keine sechs Richtigen!
Denn was könnten wir nach einem Lottogewinn noch tun, um uns dieses Glück der selbst vorgegaukelten Träume wieder zu erkaufen? Glauben Sie wirklich, Sie könnten genauso gut von einem zweiten Lottogewinn träumen, wenn Sie die ersten 10 Millionen schon auf dem Konto hätten?
Doch egal, ob Lottogewinn oder nicht, auch egal, ob wir uns überhaupt ein Los kaufen, lohnt es sich, wenn wir uns Gedanken darum machen, wie wir unser Glück verstetigen.
Denn eines wissen wir ja jetzt schon: Glück zu ergattern ist keine Frage des Geldes, es ist vor allem eine Frage des Glücks.
Glücklich ist der Mensch im Glück
Nur wo finden wir dieses Glück? Wie können wir‘s erreichen, ohne danach zu jagen? Dazu blicken wir auf den Begriff der Demut. Diesen gab es schon bei den Griechen und bei den Römern. Und auch in der Bibel spielt er eine zentrale Rolle. Da geht es darum, die eigene Unzulänglichkeit als Mensch zu erkennen und sich der Vollkommenheit Gottes in Demut unterzuordnen.
Und dann kam irgendwann die moderne Zeit und die Menschen dachten, beim Demutsbegriff geht es nur noch um Unterordnung und Demütigung. Und wer will schon gedemütigt werden?
Demut ist besser als ihr Ruf
Für den großen Atheisten Friedrich Nietzsche gehörte Demut dann sogar „zu den gefährlichen, verleumderischen Idealen, hinter denen sich Feigheit und Schwäche, daher auch Ergebung in Gott verstecken“.
Immanuel Kant – klar, der lebte vor Nietzsche – hingegen versuchte die Demut aus dem christlichen Dogma zu lösen und definierte sie so: „Das Bewußtsein und Gefühl der Geringfähigkeit seines moralischen Werts in Vergleichung mit dem Gesetz ist die Demut.“ Die Demut sei „so indirekt Indikator für die eigentliche Würde des Menschen als eines freiheitlichen Vernunftwesens.“ Zugegeben, klingt immer noch wahnsinnig kompliziert...
Der amerikanische Philosophieprofessor Robert Solomon, er starb 2007 in der Schweiz, drückte es etwas anders aus. Er verglich Demut mit einer Rede zu einer Filmpreisverleihung.
Dabei solle man Arroganz und falschen Stolz vermeiden. Aber Selbstkasteiung sei auch falsch. Er sagte: „Demut muss nicht erbärmlich sein; sie ist oft nicht mehr als eine realistische Einschätzung des eigenen Beitrags und die Anerkennung des Beitrags anderer.“
Wo sich Demut sogar im Wirtschaftsleben zeigt
Nachdem der Begriff der Demut also lange Zeit einen eher hässlichen, unterwürfigen, erbärmlichen, mutlosen, charakterlosen, unambitionierten Beigeschmack hatte, kommen wir jetzt noch mal zurück zur Ökonomie. Da gibt es nämlich seit Anfang/Mitte der 2000er Jahre tatsächlich Management-Ratgeber, die sich auf genau diesen Begriff beziehen.
Demut habe demnach, wer
• die eigenen Stärken und Schwächen erkennt,
• andere dafür anerkennt, was sie tun,
• immer lernbereit und offen ist und
• versteht, dass er oder sie nur ein kleiner Teil eines größeren Ganzen ist.
Demut wird demnach als erlernbare Tugend angesehen, die auf drei Ebenen messbare Erfolge bringt. Zum einen für die Mitarbeiter, was zum Beispiel Kreativität, Leistung und Ethik angeht, zum anderen auch für das Unternehmen, etwa in Bezug auf eine erfolgreichere Strategie oder eine bessere Fehlerkultur, und drittens für die Führungskraft selbst, beispielsweise was verbesserte Beziehungen und eine erhöhte Wahrnehmung von Führungspotential angeht.
Warum wir unser Glück eben nicht nur selbst in der Hand haben
Ich will Ihnen hier und jetzt nun aber wirklich keinen Management-Ratgeber an die Hand geben. Ich möchte Ihnen nur noch einmal mitteilen, was ich selbst vor drei Jahren im Gifhorner Ratssaal sagte, nur wenige Stunden nachdem ich zur großen Überraschung aller und vor allem meiner selbst zum Gifhorner Schützenkönig ausgerufen wurde und mein Glück kaum fassen konnte:
Glück ist es, was über vieles in unserem Leben entscheidet. So entscheidet Glück darüber, ob wir in einem guten Elternhaus aufwachsen. Es entscheidet darüber, ob wir in der Grundschule eine Klassenlehrerin bekommen, die zum Lerneifer motiviert – oder völlig desillusioniert. Und Glück entscheidet auch darüber, ob wir in einem Land geboren werden, in dem wir gut und sicher leben können – oder in einem Land, in dem Not und Elend herrschen. Oder vielleicht sogar Krieg.
Und eben weil es oft nur Glückssache ist, ob uns in unserem Leben Gutes oder Schlechtes widerfährt, gehört neben all der Freude übers Glück auch Dankbarkeit – und vor allem Demut.
Denn Demut hilft uns dabei, nicht die Bodenhaftung zu verlieren. Sie lehrt uns, ehrlich und bescheiden zu sein. Höflichkeit, Freundlichkeit und Rücksichtnahme sind uns wichtig, genauso Toleranz gegenüber anderen Meinungen.
Demut lehrt uns Selbstliebe und Akzeptanz der eigenen Schwächen. Sie steht für Wertschätzung und Respekt gegenüber allen Lebewesen, für
Authentizität und Anstand.
Wenn Du glücklich sein willst, dann sei es doch einfach
Zugegeben: Den Demutsbegriff gänzlich zu verinnerlichen, ist natürlich schwer. Danach zu leben noch viel mehr. Und das ewige Scheitern im Alltag gehört auch dazu.
Doch wer sich immer mal wieder die Demut vor Augen hält, findet damit mit Sicherheit auch – so ganz nebenbei – zum Glück.
Glück können wir uns eben nicht erkaufen. Glück ist ein scheuer Glanz, der flieht und sich entzieht, wenn wir ihm zu sehr nachjagen.
Glück entsteht nicht aus dem Materiellen, sondern aus einer Geisteshaltung. Aus Aufmerksamkeit, aus Dankbarkeit – und aus dem leisen Wissen um unseren kleinen Platz im Großen Ganzen.
Man hat Leo Tolstoi den Satz zugeschrieben: „Wenn Du glücklich sein willst, sei es.“ Ob er ihn wirklich gesagt hat, ist ungewiss. Wahrscheinlich nicht. Gewiss ist aber: Glück ist eine Entscheidung der Wahrnehmung.
Es kommt darauf an, Glück zu erkennen und anzunehmen
Darum wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, genauso wie den Gästen am Abend der Gifhorner Hutverleihung heute etwas sehr Einfaches: dass nichts fehlt.
Dass Sie jeden Tag aufs Neue spüren, gesehen, verstanden und verbunden zu sein. Und dass aus dieser Verbundenheit – ganz ohne Nachjagen – ein wenig Glück entsteht.
Genießen Sie die ruhige Zeit zwischen den Jahren und das Glück, das sich Ihnen auch im neuen Jahr sicher jeden Tag aufs Neue leise zu erkennen gibt – vielleicht in Dankbarkeit, und vielleicht auch in ein kleines bisschen Demut.