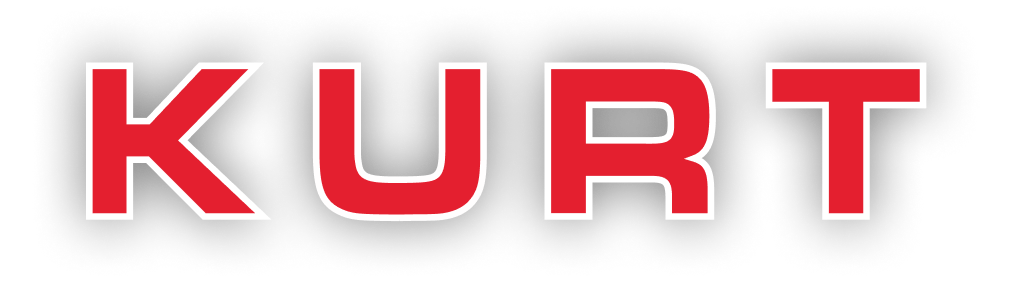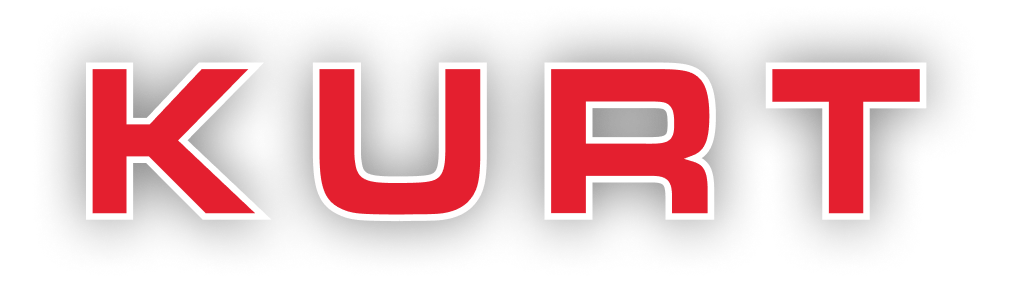Stolpersteine
Gifhorns Nazis nahmen ihm den Lebensunterhalt: Erich Lehmann musste seine Schlachterei abgeben – Später verzögerte die Stadt die Wiedergutmachung
Manfred Grieger Veröffentlicht am 29.12.2021
Erich Lehmann litt unter den Nationalsozialisten in Gifhorn und überlebte unter falschem Namen. Jetzt erinnert ein Stolperstein vor dem Schillerplatz 2 an ihn.
Foto: Mel Rangel
Stolpersteine erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus in und aus Gifhorn – ihre Biographien stellt KURT in einer Serie vor. Diesmal geht es um Erich Lehmann, dessen Mutter in Auschwitz ermordet wurde und der von der Stadt Gifhorn in der Zeit des Nationalsozialismus um seine Schlachterei gebracht wurde – und nach dem Krieg verzögerte die Stadtverwaltung auch noch die Wiedergutmachung.
Der Sohn aus erster Ehe zwischen Johannes Erich Hermann Wilhelm Lehmann und seiner Ehefrau Bertha, geborene Magnus, verlor seinen Vater bereits im ersten Lebensjahr. Der Vater fiel im Ersten Weltkrieg. Als Erbe des Schlachterbetriebs ausersehen, legte auch sein Stiefvater Georg Müller Wert auf seine Ausbildung im Metzgerfach.
Zwischen 1928 und 1931 absolvierte Erich Lehmann seine Lehrzeit in Wittenberge an der Elbe und arbeitete danach im väterlichen Betrieb mit. Nach dem Tod von Georg Müller erschwerten antijüdische Behördenmaßnahmen und die antisemitische Stimmung in der Stadt Gifhorn die Übernahme des Metzgereibetriebs.
1936 wurde Erich Lehmann das Schlachtkontingent drastisch beschnitten, so dass er in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Wegen angeblich baulicher Mängel, die ihm die Stadtverwaltung vorwarf, musste er seinen Betrieb am Schillerplatz 2 im Juni 1938 verpachten, bevor ihm das gesamte Schlachtviehkontingent gestrichen wurde. Daraufhin sicherte er sich seinen Lebensunterhalt zunächst als Bauarbeiter.
Erich Lehmann mit seiner Frau Herta – zurückgekehrt nach Gifhorn zog sich die Freigabe seines Schlachtbetriebs quälend in die Länge.
Foto: Ulla Löwenberger

Nach Kriegsbeginn verzog Erich Lehmann nach Hannover, um in der Anonymität der Großstadt seinem Metzger-Beruf nachzugehen. Eine Heirat war ihm als „Mischling I. Grades“ versagt. Seine Mutter, Bertha Müller, starb in Auschwitz. Um der polizeilichen Überwachung zu entgehen, verzog er unter falschem Namen ins Bergische Land, wurde dort noch unter seiner angenommenen Identität zur Wehrmacht eingezogen und geriet in Kriegsgefangenschaft. Zurückgekehrt nach Gifhorn, verzögerte sich die Freigabe seines Betriebs. Auch die Wiedergutmachungsverfahren für sich und seine ermordete Mutter zogen sich ebenfalls quälend in die Länge.
Dieser Text ist Teil der Broschüre „Stolpersteine in Gifhorn“, kostenfrei erhältlich im Stadtarchiv und in der Stadtbücherei.
Die Forschung zu Opfern des Nationalsozialismus in und aus Gifhorn geht weiter. Hinweise sammelt das Kulturbüro der Gifhorner Stadtverwaltung:
Tel. 05371-88226
kultur@stadt-gifhorn.de