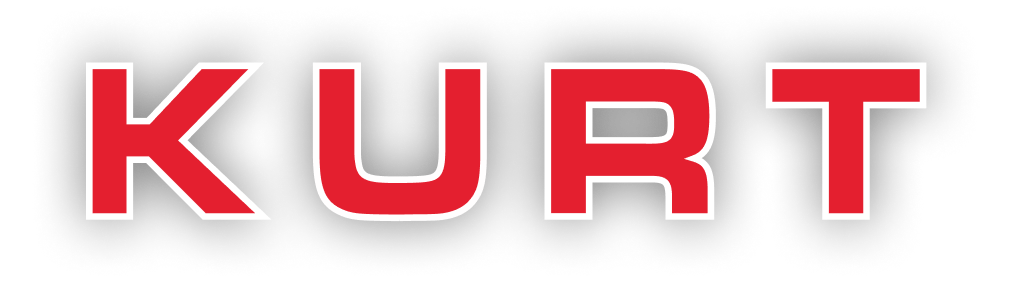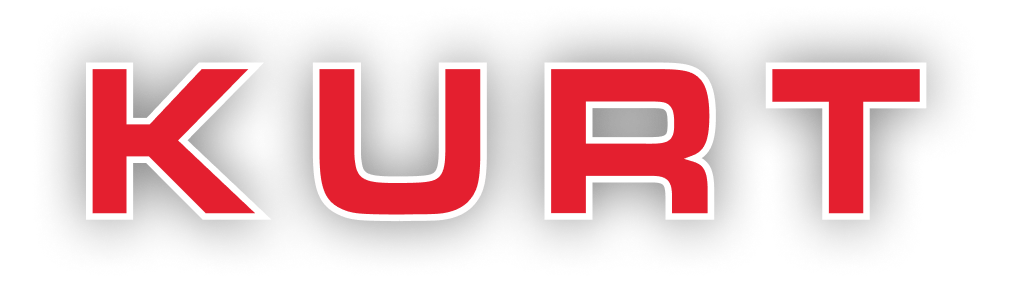Kunst
Wir hatten also auch die falsche Waschmaschine: Für Christian Riebe funktioniert die Kunst nicht mehr
Christian Riebe Veröffentlicht am 22.12.2022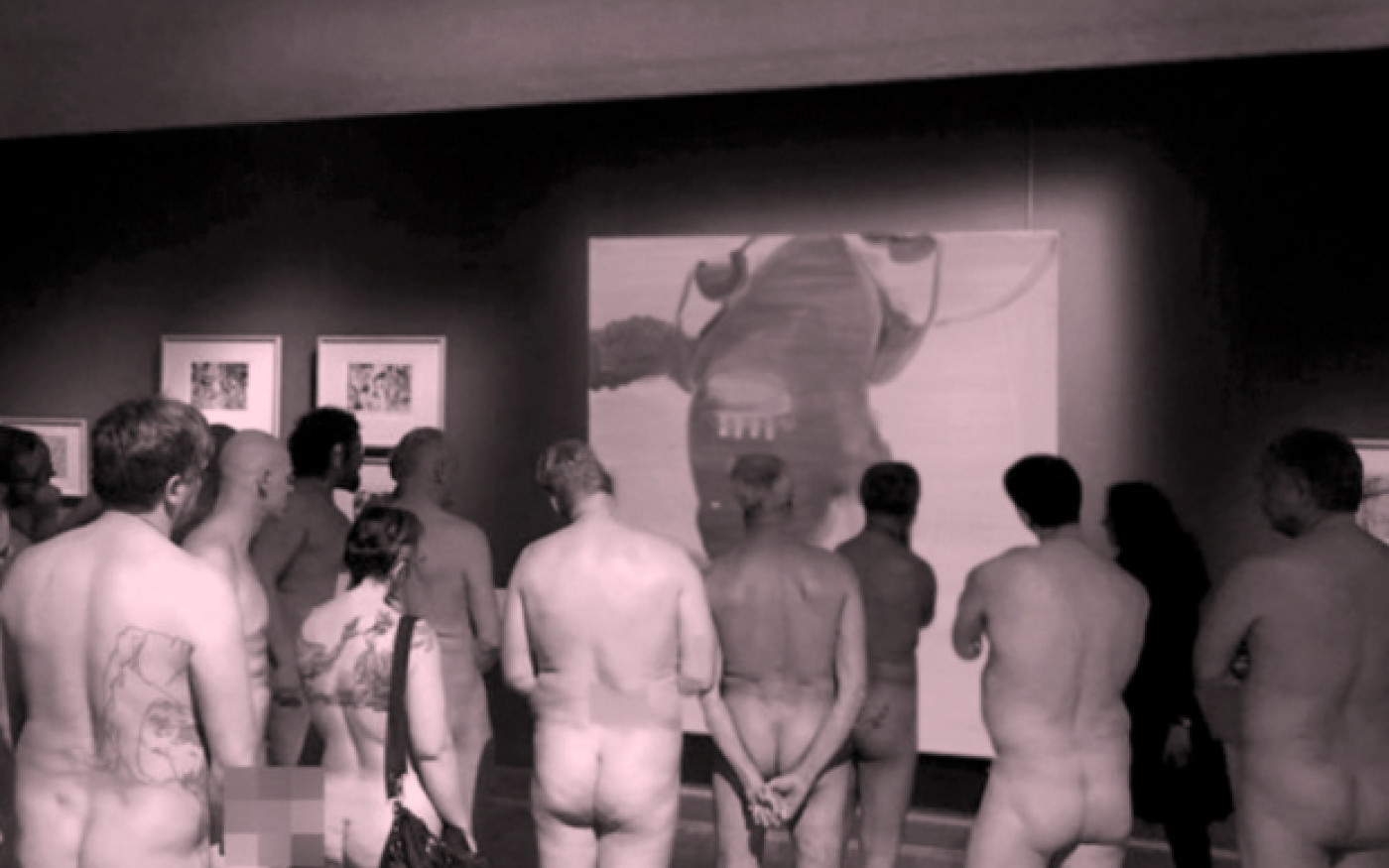
{die Nackten, rosa} FKK-Führung durch einen Kunstverein.
Foto: Privat
Was will uns der Künstler eigentlich sagen? Diese Frage – eingebimst in unser aller Schulzeit – versperrt den Blick aufs Wesentliche: Denn Künstlerinnen und Künstler produzieren keine verkappten Rätsel und Intelligenztests, sie haben mit der Vorlage ihrer Werke schon alles gesagt. So sieht‘s Christian Riebe, der Möchteungern-Künstler aus Hannover, der 1991 als Stipendiat ins Künstlerhaus nach Meinersen kam und dort nun nach mehr als 30 Jahren wieder ausstellte. Für KURT hat er seine steile These – die der falschen Betriebsanleitung für Kunst – in einen Gastbeitrag gepresst.
Irgendetwas funktioniert nicht mehr: Die offiziellen Beteuerungen, Kunst sei ein höchstes Gut, wirken merkwürdig hohl. Pflichtbewusst lässt man Künstler noch gelegentlich öffentlich zu Wort kommen, zum Beispiel im Radio. Mit dünner Stimme erklären sie dann energisch, für alles Mögliche zuständig zu sein: Weltfrieden, Selbsterkenntnis, Naturerfahrung, Architekturkritik und so weiter. Natürlich glaubt ihnen das niemand, und niemand wird aus ihren Bekenntnissen irgendwelche Konsequenzen ziehen. Man wundert sich immer, dass der Moderator nicht zu kichern beginnt.
An der größten deutschen Kunstschau war das einzig Interessante ihr skandalöser Absturz, und in den Ausstellungshäusern zeitgenössischer Kunst steht der gleiche fahle Nebel, der auch die Kirchen füllt: der Nebel peinlich gezwungener Andacht.
Einigermaßen solide steht Kunst nur noch als Marktsegment. Findige Kaufleute bewegen mit Kunstwerken noch ordentlich Geld. Tatsächlich ist Kunst für solche Zwecke bestens geeignet: die Möglichkeit willkürlicher Wertsetzung und eine Prominenz, die sich umstandslos fingieren lässt. Der elektrisierende Hauch vergangener großbürgerlicher Luxusbedürfnisse weht durch diesen Markt: die Jagd nach dem absoluten Unikat. Kunstwerke sind im gehobenen Lifestyle-Sortiment immer noch eine harte Währung. Mehr aber auch nicht.
{das schrotte Museum} Museum auf der Internetseite der Local Fist.
Foto: Privat

Nun sind wir alle mal einem Celan-Gedicht begegnet. Oder wir standen vielleicht vor einer dieser magischen Vitrinen von Joseph Beuys. Wer nicht ganz stumpfsinnig ist, merkt sofort, dass das etwas ganz anderes ist als der landläufige Documenta-Mitmach-Quatsch oder die steigende und sinkende Flut rasch hingemachter Malerfürsten. Man kann sich dann fragen, warum die Kunst eigentlich nicht mehr richtig funktioniert.
Gehen wir vor wie bei einer Waschmaschine, die nicht mehr waschen will. Warum funktioniert sie nicht? Ein erster Vorschlag: Vielleicht haben wir die falsche Betriebsanleitung.
Die Gegenwartskunst ist voller Betriebsanleitungen, oft besteht sie ganz daraus. Nehmen wir zum Beispiel die bekannteste Form der Anleitung, nämlich die obligatorische Predigt der professionellen Eröffnungsredner. Wie funktioniert sie, und was richtet sie an?
Um es kurz in Erinnerung zu rufen: Ein versierter Redner konfrontiert uns vielleicht zuerst mit einer These oder einem wichtigen Zitat (schlimmstenfalls mit einem Picasso-Zitat) und führt uns dann daran wie an einer thematischen Halteleine solange an den ausgestellten Kunstwerken entlang, bis Kunstwerk und These sich mögen oder bestenfalls sogar gegenseitig belegen.
Eine andere typische Herangehensweise besteht darin, das Detail einer Arbeit herauszugreifen und es uns kurzerhand als etwas Exemplarisches zu präsentieren. Danach verweist dann jede Frakturschrift im Bild auf das Dritte Reich und jeder abgebildete Pilz repräsentiert automatisch die gesamte Natur oder vielleicht Hiroshima.
Und wenn das alles nicht klappt, dann bleibt ja immer noch die Möglichkeit, die ausgestellten Arbeiten irgendwie in den Kontext der Kunstgeschichte einzupassen, um auf diesem Weg dann zu verbindlichen, allgemein verständlichen Erkenntnissen zu kommen.
Allen drei Wegen liegt die gleiche Absicht zu Grunde: Wir und die Werke sollen sich auf der Ebene der Abstraktionen begegnen, also dort, wo wir alle durch einen ähnlichen Bildungsweg oder den selben kulturellen Hintergrund miteinander verbunden sind. Diese Ebene, auf der man dann offenbar erst vernünftig und lehrreich über die Kunstwerke sprechen kann, das ist das mehr oder weniger gebildete, mehr oder weniger gesunde Alltagsbewusstsein.
Christian Riebe, der seine künstlerischen Arbeiten jüngst im Künstlerhaus Meinersen zeigte.
Foto: Privat

Um nun gleich mit den Einwänden gegen die professionelle Betriebsanleitung zu beginnen: Das gesunde Alltagsbewusstsein ist schon mal kein Bezirk, in dem Künstler besonders viel verloren haben. Viele wirklich verehrungswürdige Künstler haben diesen Bezirk nie betreten – weder als Menschen noch in ihrem Werk. Was sie zu sagen hatten, war keinesfalls alltäglich. Es ist also nicht einzusehen, warum jegliche künstlerische Produktion ungefragt in die Sprache des Common Sense gezerrt werden sollte, nur damit wir mühelos „schlau daraus werden“ können. Das kuratierende Fachpersonal scheint davon überzeugt, dass Kunstwerke uns eigentlich nur Dinge erzählen sollen, die wir im Grunde schon wissen.
Genau diesem Anforderungsprofil folgt ein professioneller Vermittler, wenn er voraussetzt, dass Kunst bitte abgemachte Themen verhandelt, politische Anstandsregeln reflektiert oder zu sozialer Reparatur verpflichtet ist. Er befördert die Vorstellung einer Kunst, die helfen will, den Alltag zu erklären und zu verbessern. Das ist wahrscheinlich nett gemeint. Was wir aber insgeheim wirklich nötig hätten, wäre das exakte Gegenteil: eine Kunst, die den Alltag bekämpft.
Außerdem ist Folgendes der Fall: Mit der Abstraktions- und Deutungsverpflichtung, mit der uns solche Reden infizieren, segeln wir alle unweigerlich dorthin zurück, wo wir während unserer Schulzeit schon mal waren, nämlich in den Kunst- oder Deutschunterricht, wo ja auch immer alles auf die Frage hinauslief: Was will uns der Künstler eigentlich sagen, und wie lautet die konkrete, nützliche Botschaft, die da ja irgendwo im Kunstwerk versteckt sein muss? Diese Frage ist natürlich Unsinn, denn sie setzt voraus, dass Künstler auch einfach eine simple, allgemeinverständliche Aussage hätten tätigen können, und als hätten sie dann heimtückisch irgendwas absichtlich Unverständliches in die Welt gesetzt, zum Beispiel ein Gedicht. In Wirklichkeit haben ernstzunehmende Künstler das, was sie zu sagen haben, natürlich erschöpfend mit der Vorlage ihrer Werke gesagt.
Der Apparat ist der „automatische Lehrer“ – zu sehen auf der Internetseite der Gruppe Local Fist.
Foto: Privat

Und es stimmt eben nicht, dass wirkliche Kunstwerke einfach präparierte Sortimente von Symbolen sind, die jeder ungestraft so lange entschlüsseln darf, bis er dann am Ende erleichtert bei ein paar Kalenderspruch-Weisheiten herauskommt. Man kann es nicht deutlich genug sagen: Die „Betriebsanleitung für Kunst“, die uns unsere Lehrer ausgehändigt haben, war falsch. Wer ihr heute noch folgt, bleibt ein ewiger Grundschüler. Alle Kunstwerke werden ihm wie höhere Kreuzworträtsel vorkommen oder wie hämische Intelligenztests, in denen er seine kunsttheoretische Bildung nachweisen muss.
Nun lebt diese fehlerhafte Herangehensweise, mit der wir im Schulunterricht jahrelang wehrlose Kunstwerke zerpflückt haben, leider munter fort in der „professionellen Vermittlung“. Es ist erstaunlich, dass die totale Pädagogisierung der Künste so völlig widerstandslos hingenommen wird. Dabei ist die Inpflichtnahme Bildender Kunst für offizielle Dienstleistungen irgendwo zwischen sozialem Engagement und Erwachsenenbildung doch eigentlich nichts anderes als die endgültige Domestizierung von Kunst. Und Domestizieren heißt ja bekanntermaßen: aus Wölfen Pudel machen.
Bleibt natürlich die Frage: Wenn wir also nur eine falsche und irgendwie erniedrigende Betriebsanleitung für den Umgang mit Kunst benutzen, warum erscheinen dann auch die zeitgenössischen Werke selbst so armselig und anmaßend? Warum wirken sie ebenso peinlich verblasen wie die Anweisungen, mit denen sie uns angeboten werden? Haben wir sie einfach nicht richtig betrachtet? Das wäre schön; es ist aber schlimmer.
Wir können uns die „professionelle Vermittlung“ vielleicht als einen Berg von Betriebsanleitungen vorstellen, der sich um die Kunstwerke herum erhebt. Dieser Berg ist besiedelt. Auf seinen Hängen rotieren die Vermittler: Kuratoren, Kritiker und Galeristen. Sie schaffen die Kunst zu Tage, die unter ihnen im Berg noch irgendwo entsteht. In ihren Ausstellungen sehen wir immer nur das, was ihnen angemessen erscheint. Jeder unpassende, schwer oder gar nicht vermittelbare Rohstoff bleibt ungehoben. Kurz gesagt, die Vermittler haben geputscht; sie haben Produktion und Vertrieb fast vollständig übernommen. Und auch die meisten Künstler arbeiten ihnen mittlerweile folgsam zu: Sie produzieren vorverdaute Kuratoren-Kunst. Insofern ist die verschulte kuratorische Betriebsanleitung längst nicht mehr nur eine falsche Form der Vermittlung, sie ist die verbindliche Matrix, nach der Kunst heute produziert wird.
Kehren wir zur defekten Waschmaschine zurück!
Wir hatten also die falsche Betriebsanleitung, soviel ist sicher. Das Problem ist nur:
Es ist auch die falsche Waschmaschine.