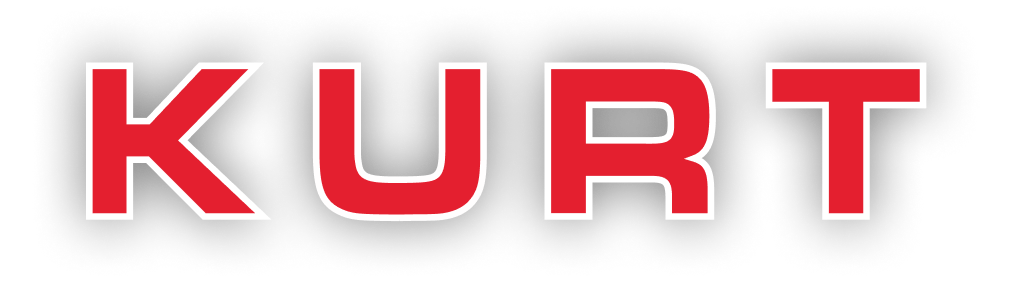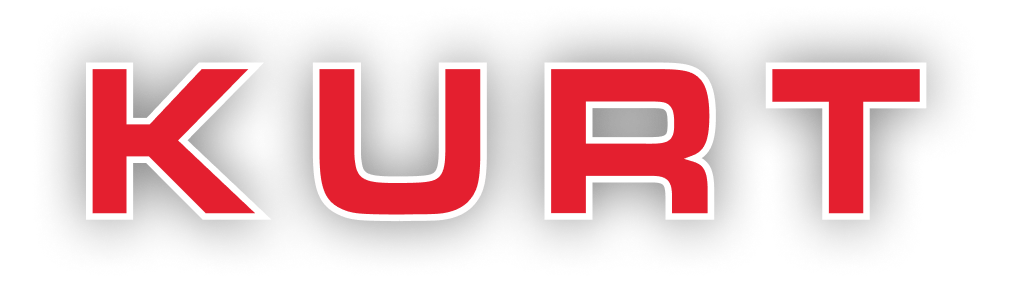Glauben & Zweifeln
Tun tut gut und ist aller Ehren wert - Was wir aus der Freiwilligenarbeit lernen können
Martin Wrasmann Veröffentlicht am 11.02.2022
Ein kostenfreier Fahrservice für Senioren, um zum Grabe der Liebsten zu kommen: Das ist das Friedhofsmobil, welches in Gifhorn von Ehrenamtlichen organisiert wird.
Foto: Martin Wrasmann
Unsere Gesellschaft würde ohne das vielfältige Engagement der Freiwilligen oder landläufig Ehrenamtlichen nicht funktionieren. In sozialen, kulturellen, politischen, sportlichen und kirchlichen Bereichen hat das Ehrenamt nicht nur strukturelle, sondern inhaltliche und identitätsstiftende Funktion. Ohne das freiwillige Engagement ist eine Demokratie nicht handlungsfähig und die Zivilgesellschaft würde sozial verkümmern. Aber wie viel Ehrenamt ist nötig, wo liegt die Grenze zu bezahltem Dienst? Welche Wertschätzung erfährt das Ehrenamt – und wie kann es gefördert und entwickelt werden?
Die Frage nach dem Engagement lässt sich nicht formelhaft lösen: Wenn immer einer einem anderen hilft, wäre allen geholfen. Also die 1:1-Regel, die mathematisch auch so aufgehen würde: Wenn jeder sich selbst hilft, wäre auch – mathematisch – allen geholfen. Was ist also die Grundformel?
Wilhelm Busch hat es so versucht: „Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt.“ Auch wenn ich Wilhelm Busch sehr mag, hier jedoch klarer Widerspruch.
Ist das Gute weiter nichts als das Unterlassen des Bösen? Bin ich wirklich schon ein guter Mensch, wenn ich nichts Böses tue?
Wenn ich mir jenen Satz zu eigen mache, dann darf ich einem Bittsteller folgende Rede halten: „Sie erwarten von mir eine Hilfe, eine gute Tat. Aber diese Tat ist schon geschehen, die Hilfe ist schon geleistet, denn: Ich habe Ihnen nichts Böses getan, ich habe Sie nicht bestohlen. Seien Sie also zufrieden, es ist genug des Guten, dass ich Ihnen nichts Böses getan habe.“ Lieben wir unseren Nächsten schon deshalb, weil wir ihm nichts antun? Ist jemand schon gut im Fußball, weil er kein Eigentor schießt?
Da komme ich schon eher mit der Formel des Apostels Paulus um die Ecke: „Bleibt niemandem etwas schuldig, außer gegenseitiger Liebe.“ Die Welt ist nicht deshalb oft so finster, weil zu viel Böses, nein, weil zu wenig Gutes getan wird. Deshalb drehe ich den Satz von Busch getrost um: Das Böse, dieser Satz steht fest, ist stets das Gute, das man lässt.
Es geht um das Gute – tun tut gut, und ist aller Ehren wert – und um die Ehre. „Was ist eigentlich die Ehre am Ehrenamt?“ Das wollten Jugendliche von Erwachsenen wissen, die sich in der Kirche engagieren. „Wie kommt Ihr dazu, Euch freiwillig für andere zu engagieren?“ Und noch einmal: „Was ist das mit dieser Ehre?“
Ehre – in bewusster Absetzung zur eigenen Geschichte gehört es bei uns zum guten Ton, die Frage der Ehre gelassen zu hören. Die deutsche Gesellschaft ist so frei, dass sie nicht diesen oder jenen Aufreger zu einer Frage der Ehre erheben muss. Das hat sie hoffentlich aus der Vergangenheit gelernt. Vom Alltagsjargon „Habe die Ehre“ bis hin zu Auszeichnungen und Ehrenmedaillen spannt sich das Wort.
Menschen, ganz gleich aus welchem Land sie kommen, haben Ehre. Eine besondere Ehre, die allen Menschen gleichermaßen innewohnt. Es ist die Ehre, in meinem Glauben, nach dem Bild Gottes geschaffen zu sein. Ehre meint auch das, was Menschen einander an Ehre zugestehen. Auf Erfahrung, auf dem Ruf und auf Anerkennung beruht menschliche Ehre. Sie kann zugesprochen oder verliehen werden. Du hilfst anderen? Das ehrt Dich! Dein Verhalten ist aller Ehren wert. Weil Du ehrenhaft bist, kann ich Dir vertrauen und Deinem Wort Gewicht geben. So weit, so gut. Allerdings ist die Ehre eines Menschen sehr zerbrechlich oder kann auf dem Spiel stehen. Schlimm, wenn Menschen in ihrem Ehrgefühl angegriffen oder verletzt werden, wenn ihnen die Ehre abgesprochen, abgeschnitten oder genommen wird.
Wie eine Impfung gegen Vertrauensmissbrauch und ehrloses Verhalten sind ethische Orientierungen wie die Zehn Gebote des Mose oder das Liebesgebot Jesu. Die Ehrenamtlichen, die sich den Fragen der Schüler:innen stellten, machten deutlich: Erstens schenkt es eine tiefe Befriedigung, anderen etwas weiterzugeben, was selbst empfangen wurde: Aufmerksamkeit und Zeit, Wissen und Hilfe. Einfach so. Zweitens stärkt der Zuspruch aus der Gemeinschaft das Selbstwertgefühl. Die anderen vertrauen mir. Drittens: Es gibt Halt, einander in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung zu begegnen.
Und für die meisten, die sich freiwillig engagieren, gilt: Es ist ein Handeln aus Leidenschaft. Oder wie es der Trapezkünstler Philippe Petit formuliert auf die Frage, warum er es riskiert, immer wieder in schwindelerregenden Höhen zu balancieren: „Wenn ich drei Orangen sehe, muss ich jonglieren, wenn ich zwei Türme sehe, muss ich ein Seil spannen und tanzen“, sagt der Artist. Was übersetzt heißt: Wenn ich Menschen sehe, die meine Kraft und Zuwendung gut gebrauchen können, muss ich handeln. Das ist das Mantra des Ehrenamts. Tun tut gut.
Martin Wrasmann, katholischer Theologe aus Gifhorn, schreibt die monatliche KURT-Kolumne „Glauben & Zweifeln“. Beipflichtungen wie auch Widerworte sind stets willkommen. Leserbriefe gerne an redaktion@kurt-gifhorn.de.