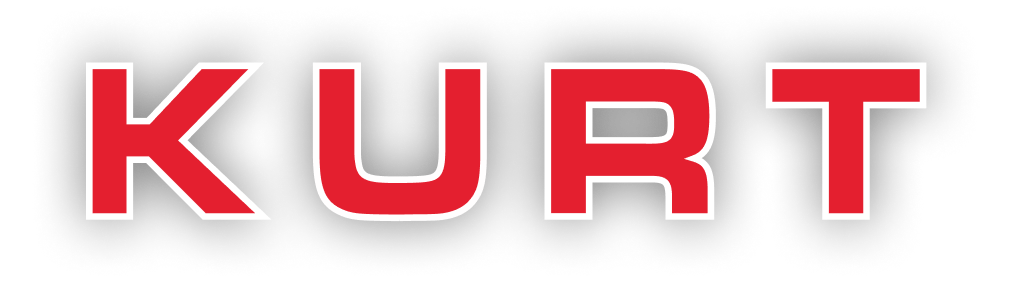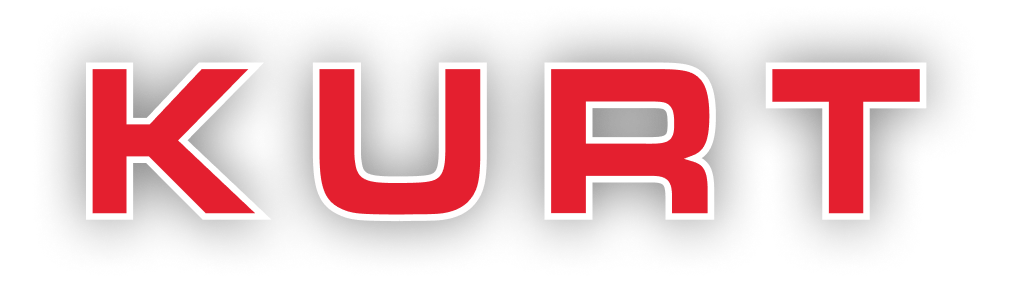Kopfüber
Von Rollkragenpullover bis Komasaufen: KURT-Kolumnist Malte Schönfeld denkt über Spießigkeit nach
Malte Schönfeld Veröffentlicht am 22.03.2022
KURT-Kolumnist Malte Schönfeld hat sich einen schwarzen Rollkragenpullover gekauft. Er fragt sich: Geht’s nun mit der Spießigkeit los?
Foto: Irina Demyanovskikh/Pexels
Ich habe mir einen Rollkragenpullover gekauft. Einen schwarzen, in dem ich aussehe wie Steve Jobs bei der Vorstellung des ersten iPhones. Ich stecke den Rollkragenpullover in die Nadelstreifenhose, und zum Frühstück schalte ich „Kulturzeit“ auf 3sat ein und esse ein Croissant. Sorgfältig führe ich meinen Kalender. Wenn ich abends nach Hause komme und aus meinen Schuhen schlüpfe, nehme ich nur noch etwas Kleines zur mir, wie es so schön heißt. Den einzigen Fleck auf der Herdplatte wische ich weg. Ich trinke Tee aus geraspeltem Ingwer, um 22 Uhr liege ich im Bett. Eines Morgens betrachte ich mich auf dem Weg zur Wohnungstür im Spiegel und bleibe hängen – bin ich eigentlich spießig geworden?
Die Spießigkeit hat keinen sonderlich hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Geizig, wenig hilfsbereit, geistig zugeknöpft – so stellt man sich den Spießer vor. Als einen linientreuen Opportunisten, der auf sich und seine Bedürfnisse schielt. Engagiert ist er nur, wenn es ihm was bringt. Der Spießer ist engstirnig und verteidigt irgendwelche Traditionen, denen er sich aus irgendwelchen Gründen zugehörig fühlt. Alles andere ist ihm wurst. Er ist ein echt wurstiger Typ.
Vor einigen Tagen habe ich den Film „Der Rausch“ geschaut. Mads Mikkelsen spielt darin einen Geschichtslehrer, dessen Leben kein Anzeichen von Ekstase und Freude mehr aufweist. Die Schülerinnen und Schüler kriegt er für Winston Churchill nicht begeistert, seine Kinder leben in einer digitalen Zwischenwelt und die Ehe ist am Ende. Seinen Freunden, die Lehrer der selben Schule sind, geht‘s ähnlich. Die Midlife-Crisis ist real. Sie entscheiden sich dafür, gemäß der Theorie des norwegischen Psychiaters Finn Skårderud, einen grundsätzlichen Pegel von 0,5 Promille zu halten, um mehr Mut und Selbstbewusstsein aufzubauen. Plötzlich geht‘s aufwärts.
Schon immer hat das miefige Reihenhaussiedlungsdeutschland bei mir ein Unbehagen ausgelöst. Die gestutzte Hecke – es gibt sie wirklich. Die Serie „Twin Peaks“ hat mir erklärt, dass es hinter der Fassade und in den sozialen Beziehungen Brüche gibt, die man mit bloßem Auge und einem Standbild nicht erkennen würde. Ich denke mir, dass unter dem gestutzten Rollrasen Leichen vergraben liegen. Hinter der Bücherwand mit dem Brockhaus und den Buddenbrooks ist jemand einbetoniert.
Doch wo fängt das an, spießig sein? Ich frage meine Mitbewohnerin, wie sie das so sieht. Sie ist Krankenschwester und arbeitet in der Notfallaufnahme in drei Schichten, sie überlegt, später noch Medizin zu studieren. Manchmal ist sie ganz gut fertig, und an freien Tagen schläft sie aus. Vormittags macht sie sich einen Kaffee und raucht – bei Wind und Wetter – eine Zigarette. Sie erklärt mir, dass sie einen Arbeitskollegen hat, von dem sie sagen würde, er führe ein spießiges Leben: 21 Jahre alt, schon Frau und schon Haus, zwei Kinder. Eine schlimme Kindheit habe er gehabt, sagt sie, Eltern, auf die er sich nicht verlassen konnte, von Welpenschutz nichts zu sehen. Sie vermutet, dass gerade dieses von außen betrachtete spießige Leben ihm eine Sicherheit gibt, die er nie vorgefunden hat, aber immer wollte. Ich fahre mit der flachen Hand über meine Spießerhose und entferne mit zwei Fingern eines meiner Haare.
In „Der Rausch“ gerät natürlich schon nach wenigen Wochen alles außer Kontrolle. Nachdem die selbsterwählten Probanden den Pegel hochschrauben, kann die Praxis mit der Theorie nicht mehr standhalten.
Die Anomalien des Lebens, die Nachtschwärmerei, das Über-das-Ziel-Hinausschießen sind in der Pandemie verloren gegangen. An ihrer Stelle ist bei mir vielleicht diese Spießigkeit getreten. Ich denke aber, dass – im besten Sinne des Wortes – gerade alles in Ordnung ist.