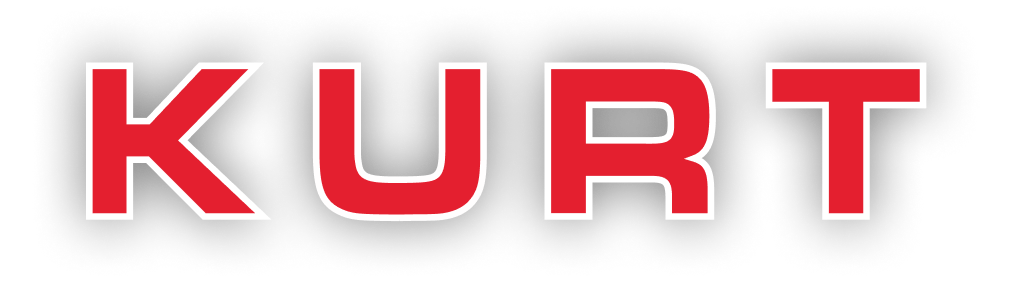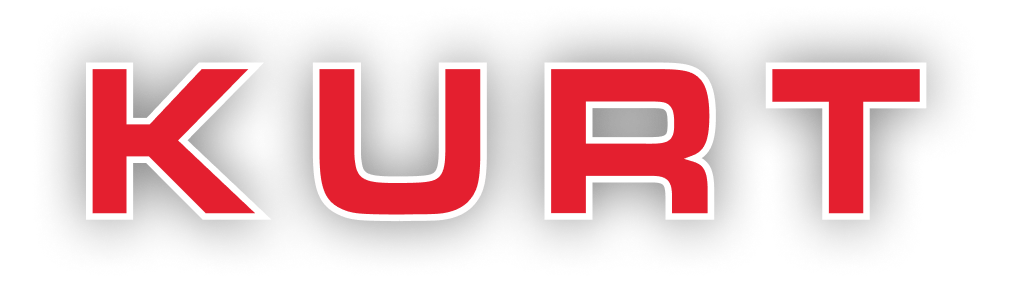Glauben & Zweifeln
Kann man mit der Bergpredigt regieren? - Wer den Blick wendet, lernt: Frieden gibt es nicht ohne Gerechtigkeit und Gleichheit aller Menschen
Martin Wrasmann Veröffentlicht am 23.02.2022
Philosophische Fragen sind wieder aktuell: Gibt es einen gerechten Krieg? Und hat gewaltfreie Konfliktlösung überhaupt eine Chance?
Foto: KURT Media
Die Frage nach Krieg und Frieden steht wieder mal nicht nur im Raum, sondern direkt vor den Türen europäischer Länder, in der Ukraine, in Belarus und wirft, wieder mal, zentrale Fragen auf nach Waffenlieferungen in Krisengebiete, nach der Abwägung zwischen Abschreckung und Diplomatie, um die Sicherung von Versorgungssystemen und Sanktionen – polare Positionen, die fast unauflösbar nebeneinanderstehen. Die alten Slogans erleben neue Bedeutung: „Frieden schaffen – ohne Waffen“, „Frieden schaffen – mit weniger Waffen“, „Schwerter zu Pflugscharen“, „Macht Frieden möglich“, „Krieg ist nicht gut – für Kinder nicht und andere lebende Dinge“. Fragen philosophischer Art liegen auf dem Tisch: Gibt es gerechten Krieg, was rechtfertigt den Einsatz von Waffen und die Bereitschaft zum Krieg? Hat gewaltfreie Konfliktlösung eine Chance?
Alexander Solschenizyn erzählt in seinem Werk „Der Archipel Gulag“ aus den Straflagern Stalins. Das dichtmaschige Spitzelsystem raubte den Inhaftierten die letzten Freiräume. Erst von dem Augenblick an besserte sich die Situation, als die Spitzel nachts umgebracht wurden. Die Tyrannei der Lagerkommandanten kam ins Schleudern – durch Gegengewalt! Solschenizyn bemerkt in Anspielung auf die Bergpredigt: „Den Spitzeln das Messer in die Brust bohren! Messer schmieden und auf Spitzeljagd gehen! – Das ist es!“
Jetzt, da ich diese Kolumne schreibe, türmen sich auf den Regalen über mir humanitätsschwere Bücher und blinken mir mit mattschimmernden, gealterten Einbänden vorwurfsvoll zu, wie Sterne durch Wolkenstreifen: Man darf nichts in der Welt durch Gewalt zu erreichen suchen! Wer zum Schwert, zum Messer, zum Gewehr greift, wird nur zu rasch seinen Henkern und Bedrückern gleich und der Gewalt wird kein Ende sein…
Hier am Schreibtisch, im warmen Arbeitszimmer, bin ich völlig einverstanden. Doch wer in Lagern gefoltert wird, wer seinen Namen verliert und nur noch eine Nummer ist, die Hände auf dem Rücken halten muss, täglich bis zur Erschöpfung robotet – für den oder die hören sich alle Reden der großen Menschenfreunde wie das Geschwätz satter Spießer:innen an.
Solschenizyn findet mit seiner Position eine breite Zustimmung – schon Mao Tse-tung schrieb: „Wir sind für die Abschaffung des Krieges, wir wollen den Krieg nicht; man kann aber den Krieg nur durch den Krieg abschaffen; wer das Gewehr nicht will, der muss zum Gewehr greifen.“
Also ist die Bergpredigt mit ihrem fundamentalen Mantra zum Frieden und zur Gewaltlosigkeit ungeeignet für das reale Leben? „Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ich aber sage Euch: Leistet dem, der Euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern, wenn Dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin.“
Im Schweizer katholischen Katechismus heißt es zu der Frage, ob die Anweisungen der Bergpredigt wörtlich zu nehmen seien: „…sind nicht wörtlich zu nehmen, weil das sowohl im privaten wie im öffentlichen Leben zu unhaltbaren Zuständen führen würde.“
Mahatma Gandhi, der hinduistische Freiheitskämpfer, hatte 1929 bekannt: „Es ist die Bergpredigt, die mich Jesus liebgewinnen ließ“, weil sie in dreifacher Hinsicht vernünftig sei: Sie habe die Freiheit des anderen im Auge, empfehle dem Geschädigten, sich nicht zur Rache zwingen zu lassen und fordere den Angegriffenen auf, den Gegner als freien Partner zu gewinnen. Aber das alles sei nur vernünftig, wenn man an die universale Kraft der Gewaltlosigkeit glaube. Gandhi hielt die Bergpredigt nur unter Glaubensvorstellungen, das heißt aus subjektiven Gründen, für vernünftig.
Für Dietrich Bonhoeffer war die Bergpredigt nur im Rahmen einer Nachfolge Jesu vernünftig. „Hier sitzt die einzige Kraftquelle, die den ganzen Zauber und Spuk einmal in die Luft sprengen kann. Die Restauration der Kirche kommt gewiss aus einem Leben nach der Bergpredigt in der Nachfolge Christi“, bekannte er 1935 gegen den NS-Terror. Und seine Finkenwalder Vorlesungen schloss er mit der Überzeugung: „Die Bergpredigt ist kein Wort, mit dem man hantieren könnte: Hier geht es nicht, da geht es nicht, dort gibt es Konflikte. Dieses Wort ist tragfähig nur, wo gehorcht wird.“ Es ist praktizierbar nur in der Nachfolge. Nur unter Glaubens-, das heißt subjektiven Bedingungen, hielt Bonhoeffer die Bergpredigt für vernünftig. Aber er hielt sie eben für die einzige Ethik, die dem NS-Regime zu widerstehen vermöge.
In diesen zunächst kontrovers scheinenden Positionen, die oft unversöhnlich nebeneinander stehen, liegt doch zugleich auch ein Lösungsweg: Es geht schon um die Frage, nach welchem Menschenbild ich mein persönliches Leben oder meine politischen Entscheidungen ausrichte („Die Würde des Menschen ist unantastbar“). Und was mute ich denen zu, für die ich verantwortlich bin. Kriegerische Auseinandersetzungen dienen im Wesentlichen den eigenen, oft nationalen Interessen. Die Bergpredigt wendet den Blick, das Leben und seine Zusammenhänge aus der Sicht des oder der jeweils anderen zu betrachten. Dann gilt nicht mehr Germany first, America first, Russland first, China first. Die großen Männer und Frauen der Friedensbewegungen haben immer wieder auf den universalen Kontext verwiesen und verdeutlicht, dass es Frieden ohne Gerechtigkeit und Gleichheit aller Menschen nicht geben wird. Das gilt auch für den inneren Frieden in unserer Demokratie.
Ich weiß, es gibt keine sofortigen Lösungen, ich kann nur hoffen und beten, dass die Verantwortlichen in der Politik richtige Worte finden und aus Haltungen agieren, die Respekt und Achtung abfordern. Das gilt auch im Privaten – etwa mit Gandhis fünf Vorsätzen für jeden Tag: „Ich will bei der Wahrheit bleiben, ich will mich keiner Ungerechtigkeit beugen, ich will frei sein von Furcht, ich will keine Gewalt anwenden, in will in jedem zuerst das Gute sehen.“
Martin Wrasmann, katholischer Theologe aus Gifhorn, schreibt die monatliche KURT-Kolumne „Glauben & Zweifeln“. Beipflichtungen wie auch Widerworte sind stets willkommen. Leserbriefe gerne an redaktion@kurt-gifhorn.de.