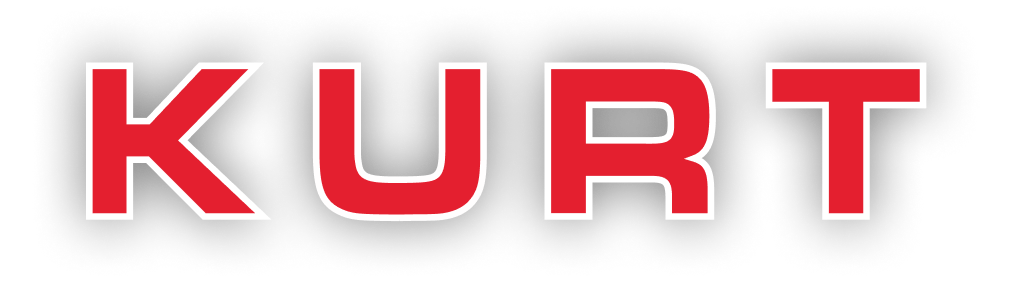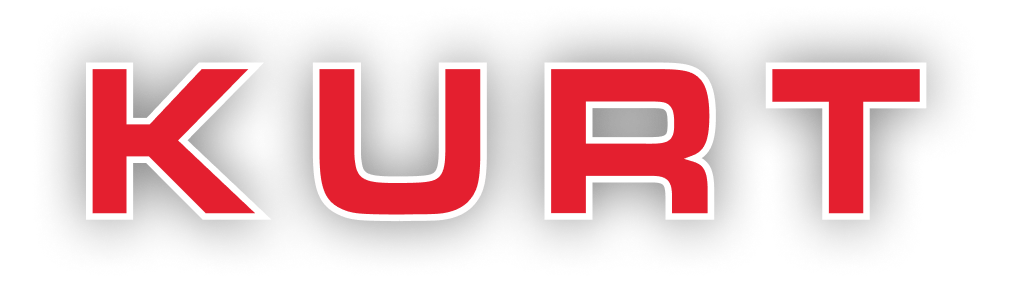Krieg & Frieden
36 Stunden Fahrt für ein klein wenig Hoffnung - KURT-Volontär Malte Schönfeld war Teil eines Gifhorner Hilfskonvois, der Spenden an die ukrainische Grenze brachte
Malte Schönfeld Veröffentlicht am 19.03.2022
Insgesamt zwei 40-Tonner können die Helfer mit den Spenden aus Gifhorn beladen.
Foto: Malte Schönfeld
Wenige Tage nach der Invasion der russischen Armee in die Ukraine versammelt sich in Gifhorn eine Gruppe von Personen, um den Menschen im Krisengebiet zu helfen. Unzählige Bürgerinnen und Bürger wühlen durch ihre Hauswirtschaft und spenden Kleidung, Decken, Essen, Trinken und medizinische Erst-Versorgung. In zentralen Annahmestellen türmen sich die Care-Pakete meterhoch, später werden sie in Transporter und LKW verladen, um an die Grenze zur Ukraine gebracht zu werden. KURT-Volontär Malte Schönfeld war Teil des Hilfskonvois, das Ziel: das slowakische Vyšné Nemecké.
Es ist Donnerstag, der 24. Februar 2022. Als ich um 7.45 Uhr von meinem Wecker aus dem Schlaf gerissen werde, sehe ich die Push-Nachrichten auf meinem Handydisplay. Es ist noch dunkel, sie strahlen mich kalt an. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Drohungen wahr gemacht, in der Nacht und am Morgen greift die russische Armee Munitionslager, Kasernen, Fernsehtürme und Flugplätze an, Luftangriffe auf Charkiw und Kyjiw werden vermeldet. In mehreren meiner WhatsApp-Gruppen prasseln die Nachrichten im Sekundentakt ein. Es fühlt sich wie einer dieser Tage an, wie der 11. September oder die Terroranschläge in Paris im November 2015.
Auf dem Weg zur Arbeit schaue ich im Zug die Live-Sendung von Phoenix. In der Redaktion fällt es mir schwer, meinen Terminen nachzukommen, alle zehn Minuten aktualisiere ich den Ticker auf Zeit Online. Ich sehe die ersten Videos von Hubschraubern, die abgeschossen werden. Mir wird klar, dass das keine Aufnahme aus der Vergangenheit ist und kein Truppenübungsplatz. Abends, als ich nach Hause komme, geht‘s mir körperlich schlecht, mir ist übel, kurz habe ich die Befürchtung ich müsse mich übergeben. Ich trinke vier große Gläser Rotwein. Wegen der Übelkeit? Aus Überforderung? Weil ich das mal in irgendeinem Film gesehen habe? Keine Ahnung.
Die Erkenntnis, keine Ahnung zu haben, ist das bestimmende Gefühl der nächsten Tage. Ich schreibe mit einem Bekannten aus der Bundeswehr, er ist Panzergrenadier-Offizier. Politisch sind wir sicherlich nicht immer einer Meinung, aber ich sehe, dass er diese Ahnung hat. Militärisch kann er mit den anfangs wenigen, dann zunehmenden Meldungen einschätzen, was dort vorgeht. Ich lerne.
KURT-Mitarbeiter Malte Schönfeld füllt die letzten Lücken mit Schlafsäcken, dafür krabbelt er drei Meter in die Höhe.
Foto: Malte Schönfeld

Bis dato war die Bundeswehr für mich ein Trupp von Leuten, der beim Hochwasser hilft. Über die miserable Ausstattung der deutschen Bundeswehr habe ich gelächelt. Wenn die USA von Deutschland das Nato-2-Prozent-Ziel eingefordert haben, habe ich mit den Augen gerollt. Ich war der Meinung, dass jeder Euro, der nicht in die Bildung, sondern ins Militär investiert wird, ein giftiger Euro ist. In diesen Tagen verkündet Olaf Scholz, 100 Milliarden Euro für die Ausstattung der Bundeswehr bereitstellen zu wollen. Ich nicke. Das scheint also der Preis zu sein, den man für die „Zeitenwende“ zu zahlen hat.
Sechs Tage nach der Invasion schreibt ein Freund in einer WhatsApp-Gruppe. Man müsse was tun, in Gifhorn hätten sich helfende Hände gefunden, die Spenden annehmen und sortieren. Am Freitag, zwei Tage später, sollen die Spenden per Hilfskonvoi an die ukrainische Grenze gebracht werden, er habe bereits mit seinem Vater gesprochen, den Transporter könne er haben, er brauche jetzt nur noch einen Mitfahrer, schließlich würde allein die Hinfahrt zwölf Stunden dauern. Ich überlege kurz und sage zu. Aus Pazifismus? Wegen meiner großen Hilfsbereitschaft? Eher nicht.
Je länger ich darüber nachdenke, desto unwohler ist mir dabei. Ich bin überarbeitet, habe die Tage schlecht geschlafen, im Grunde genommen bräuchte ich keinen Transporter, sondern ein Bett. Während der vergangenen Woche hat sich bei mir ein Gefühl der Taubheit eingestellt, ich fühle mich ein wenig wie unter der berühmten Glasglocke. Ich denke mir: Wenn ich sowieso nichts spüre, kann ich genauso gut auch Anstrengungen in Kauf nehmen.
Am Donnerstagabend treffen sich die Fahrer, die Route wird besprochen. Als ich dann am Freitagabend wieder zum Treffpunkt stoße, hat sich der Plan geändert: Ursprünglich sollte die Fracht an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht werden, aus unterschiedlichen Gründen navigieren wir nun die Slowakei an. Die Kartons standen in der Lagerhalle bis hoch zur Decke, mittlerweile sind sie auf die Fahrzeuge verteilt. Es sind bestimmt 50 Personen vor Ort, ein Caterer hat Bratkartoffeln, Rotkohl, Bohnen und Bratwürstchen bereitgestellt. Um 21.30 Uhr setzen wir uns in Bewegung.
Jeder Fahrer sitzt drei, vier Stunden am Steuer, dann wird getauscht. In den kurzen Pausen wird lange geraucht. Wir fahren nachts über Leipzig und Dresden nach Polen, erst Wrocław, dann Kraków. Schon beim Sonnenaufgang Schäfchenwolken. In Polen Hügel, Hügel, dann weite Tannenwälder, dahinter ein kleines Dorf, dann wieder Hügel. Durch den Frost liegt auf allem eine dünne Eisschicht. An der Mautstelle gibt es Probleme mit unseren Papieren. Telefongespräche, wir müssen dennoch zahlen. An den Landstraßen stehen Marienstatuen, Jesus-Kreuze und kleine Kapellen. Vielleicht hilft das ja.
Gifhornerinnen und Gifhorner reisten in mehr als zehn Fahrzeugen an, um an der slowakisch-ukrainischen Grenze kräftig mit anzupacken.
Foto: Privat

Als wir durch die Slowakei fahren, ist es ruhig bei uns in der Fahrerkabine. Der Kater der Koffeintabletten, die ich mir extra in der Apotheke gekauft habe, schlägt ein. Nach 16 Stunden erreichen wir schließlich die Grenze. Zwei Knotenpunkte, einer für die Flüchtenden und einer ungefähr einen Kilometer weiter für die Fahrzeuge, die die Grenze in Richtung der Ukraine passieren wollen. In der Ferne sieht man Soldaten oder Grenzbeamte mit schweren Gewehren über der Schulter. Eine Gruppe Flüchtender geht schwer bepackt und gebeugt an uns vorbei, zwei Frauen schieben einen Kinderwagen. Bis auf sie sehe ich kein Leid, kein Elend. Es ist still. Dann kreisen zwei Hubschrauber über uns, kurz macht sich eine Art von Panik breit, die sich wieder legt, als das rote Kreuz auf dem Tank erkennbar wird.
Wir machen uns an die Arbeit. Erst entladen, dann beladen. Die Spenden gehen in zwei 40-Tonner, gefahren werden sie von zwei ukrainischen Männern einer slowakischen Spedition. Ihre Gesichter zeigen, was in der letzten Woche los war: Sie sehen entkräftet aus, abgekämpft. Dennoch helfen sie, um die Kartons von den Transportern in die LKW zu tragen. Es ist eine schweißtreibende Aktion bei null Grad, am Ende haben wir 50 Tonnen Textilien, 10 Tonnen Hygieneartikel und 6 Tonnen Nahrungsmittel verladen – und für diesen Tag hat es noch nicht mal alles in die LKW geschafft. Die Arznei verstecken wir so gut es geht unter den Decken und Schlafsäcken, aus Angst, sie könnten später auf dem Schwarzmarkt landen.
An der Grenze habe ich das Gefühl, dass sich zwei Zeitachsen auftun: Die Flüchtenden, die aus der Ukraine kommen, reisen nun in den Westen, per Bustransfer, Zugfahrt oder in privaten PKW. Die LKW-Fahrer dagegen begeben sich nun ins Herz des Krieges. Die einen haben ihr Leben verlängert bekommen, für die anderen könnte schon morgen alles vorbei sein. Die Bomben, das Sirenengeheul, die weinenden Väter, die ihre weinenden Kinder verlassen, um die Hauptstadt zu verteidigen, die zersprengten Krankenhäuser, die düsteren Fernsehansprachen aus dem Kreml, die mutigen Worte aus Kyjiw, Maschinengewehrsalven, Tschornobyl, die Panzer, der Tod – wie nah und doch so fern ich dem Ganzen war, wird mir erst auf der Heimfahrt bewusst. Genauso, wie eng beieinander Krieg und Frieden noch immer liegen.
Um 9 Uhr morgens am Sonntag falle ich in mein Bett, 36 Stunden waren wir unterwegs, eine Stunde Schlaf habe ich gehabt. In meinem Kopf ist es ganz laut, so als würde durchgehend eine alte Maschine laufen. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber es kommt eine Nachricht auf mein Handy: Die Spenden wurden erfolgreich überbracht, ein Transport hat es sogar bis nach Kyjiw geschafft. Die Ukrainerin, die darüber berichtet, sagt, sie und ihre Leute hätten Tränen der Freude in den Augen.
Geflüchteten-Hilfe ist immer gesucht
Personen, die Geflüchteten Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, können sich unter der Mail-Adresse ukrainehilfe@gifhorn.de melden.
Personen, die bei Behördengängen oder dem Dolmetschen helfen wollen, können sich unter ehrenamt-ukraine@gifhorn.de melden.