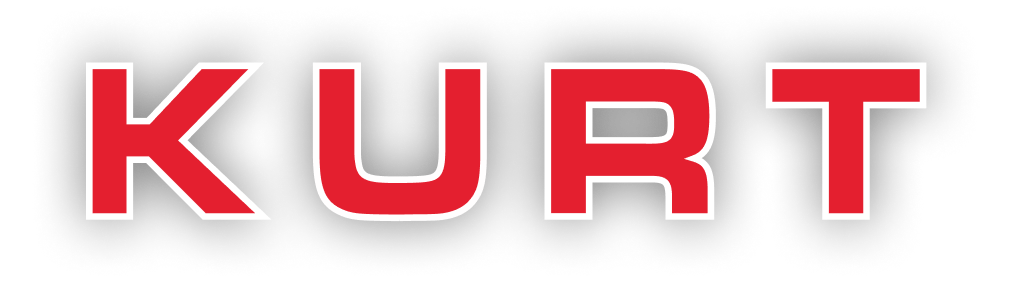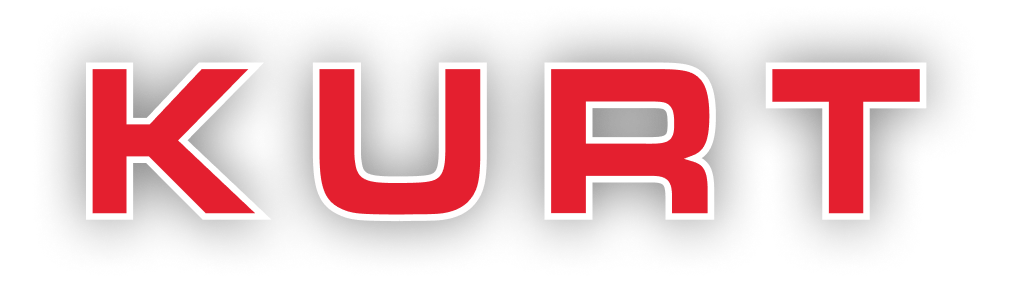Geschichte
Als „es“ endlich endete: Historiker Manfred Grieger zur Befreiung Gifhorns vom Nationalsozialismus und zu ungewisser Zukunft
Manfred Grieger Veröffentlicht am 20.05.2025
Zum 80. Jahrestag der Befreiung Gifhorns vom Nationalsozialismus hielt der Historiker Prof. Dr. Manfred Grieger eine Rede auf dem Marktplatz.
Foto: Veranstalter
Am 11. April 1945 endeten Krieg und Nazi-Diktatur in Gifhorn – es war der Tag unserer Befreiung. US-Amerikanische Panzer rollten durch die Straßen, in den Häusern wartete man mit angehaltenem Atem, während draußen weiße Laken als Zeichen der Kapitulation im Wind flatterten. Die örtliche NS-Führung floh, die Gifhorner Parteidienststelle verbrannte ihre Akten, acht Menschen starben. Und doch war es das Ende von Terror und Gewaltherrschaft – herbeigeführt von außen, aber sehnlichst erwartet. Wie dieser Tag zu deuten ist, welche Brüche und Hoffnungen er mit sich brachte, beschrieb der Historiker Prof. Dr. Manfred Grieger jetzt bei einem Festakt zum 80. Jahrestag auf Gifhorns Marktplatz – KURT dokumentiert seine Worte in einem Gastbeitrag.
Mit dem Einmarsch – oder besser dem Durchmarsch – US-amerikanischer Soldaten endeten in Gifhorn am 11. April 1945 der Krieg und die Nazi-Diktatur. Aber der Weg zur Befreiung kostete mindestens acht Menschen in Gifhorn und seinen Ortsteilen das Leben – und nicht den Kriegstreibern, sondern – wie fast immer – vor allem unschuldigen Unbeteiligten. Der noch hier lebenden Handvoll älterer Juden drohte dann nicht mehr die Ermordung. Die ausländischen Gefangenen im Gerichtsgefängnis kamen frei. Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, viele von ihnen jahrelang zur Arbeit für den Feind gezwungen, spürten die Fron und Ohnmacht von ihren Schultern genommen.
US-Fahrzeuge auf dem Lehmweg am Katzenberg im April 1945.
Foto: Archiv Dröge/Gabriel / Kolorierung: KURT Media via Photoshop Neural Filters

Aber das Sterben ging doch weiter. Mancher G.I. fiel noch auf dem Weg zur Elbe durch deutsche Kugeln. Viele Zehntausend deutsche Soldaten wurden von der NS-Führung und willigen Militärs noch in den letzten vier Wochen im Höllenschlund des Krieges verheizt. In Bergen-Belsen starben bis zur Befreiung am 15. April 1945 noch so viele Juden und andere Opfer des Nationalsozialismus, dass sie sich zu den bekannten, geradezu ikonographischen Leichenbergen auftürmten. Selbst nach dem Eintreffen der britischen Truppen verendeten Ausgezehrte, Typhuskranke oder Apathisierte. Selbst in Gifhorn war der Massentod unter den Russen, Ukrainern, Polen und anderen, die zwar Zwangsarbeit und Krieg, aber nicht den Methylalkohol überlebt hatten, eine Spätfolge des Krieges.
Gifhorns Rathaus mit gehisster US-Flagge und amerikanischen Soldaten – heute Haus des Handwerks.
Foto: Archiv Dröge/Gabriel / Kolorierung: KURT Media via Photoshop Neural Filters

Das Diktaturende kam von außen und bedurfte der vollständigen militärischen Niederlage. Die Maulhelden der Nationalsozialisten, die anderen befohlen hatten, die Heimat „bis zum Letzten“ zu verteidigen, entschwanden beim Vorletzten schon anderswohin. Die allermeisten Gifhornerinnen und Gifhorner waren im Frühjahr 1945 schlichtweg kriegsmüde, aber noch nicht diktaturverdrossen. Sie flehten nur stumm: „Die Waffen nieder!“ Sie sehnten den Waffenstillstand, noch nicht einmal einen umfassenden Frieden herbei. Sie wollten nur, dass „es“ vorbei war. Die wortlos Gewordenen definierten nicht, was das allumfassende Pronomen „es“ umfasste. Ob die Einparteienherrschaft, die strukturelle Rechtlosigkeit, der Völkermord oder die korrupte Männerbündelei der Nazis gemeint war.
„Es“ sollte aufhören. Vor allem das Bomben, die Tieffliegerangriffe, der Tod. Und sie hofften auf das Überleben ihrer Verwandten, dass sie zurückkamen – etwa aus der Kriegsgefangenschaft. Andere, die ab 1944 in Gifhorn einquartierten „Flüchtlinge“ aus den östlichen Regionen des Deutschen Reiches, hofften auf Rückkehr in die Heimat, die Realistischeren auf eine zweite Chance. Die ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter warteten darauf, endlich in ihre Heimat zurückzukehren oder aber, wenn sie dem Sowjetsystem entfliehen wollten, in die USA, nach Kanada oder Australien emigrieren zu können.
Ein Blick aus dem Gebäude der Gifhorner Aller-Zeitung in Richtung Schillerplatz um 1945.
Foto: Anelin Brandes/Archiv Dröge/Gabriel / Kolorierung: KURT Media via Photoshop Neural Filters

Sie hören es! Ein heroisches Bild vom Ende der NS-Diktatur durch den glühenden Wunsch nach Freiheit und Demokratie zu malen, ginge an der historischen Faktizität vorbei. Die Menschen waren auf ihre Grundbedürfnisse zurückgeworfen, nahmen die nächtliche Ausgangssperre hin, sahen sich aber einer ungewissen Zukunft ausgeliefert. Denn noch wusste niemand, wie es nach der endgültigen Kapitulation, die erst am 8./9. Mai 1945 erfolgte, weitergehen würde.
Wir Heutigen sind bekanntlich klüger, wissen, wie die lokalen Geschehnisse während der Diktatur, aber auch in der Nachkriegszeit eingebunden waren in das größere Nationale und Internationale. Denn der Zweite Weltkrieg war eben nicht nur eine deutsche, sondern eine multinationale Erfahrung, die ihre Triebe, und nicht nur die mit den schmackhaften Früchten, bis heute austreibt.
Nachdem unsere Stadt am 28. Mai 1945 Teil der britischen Besatzungszone wurde, zog die britische Militärregierung ins Gifhorner Rathaus ein.
Foto: Jürgen Erdmann/Archiv Dröge/Gabriel / Kolorierung: KURT Media via Photoshop Neural Filters

Wir sind heute zusammengekommen zu einer Gedenkveranstaltung. Das ruft zur gemeinsamen Trauer über all die Toten auf, die hier oder anderswo zu Opfern wurden eines mörderischen Staatsrassismus, eines von hier ausgehenden Expansionismus und der Aufhetzung von Jung und Alt gegen die anderen, als Minderwertigere definierten. Erst der von den Alliierten durchgesetzte Frieden hat der NS-Diktatur ein Ende gemacht und Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie als großzügiges Geschenk zurückgelassen. Das gibt uns eine Aufgabe, mit dieser Gabe weiterhin etwas anzufangen.
Ein wichtiger Teil der Demokratiegestaltung ist aber das Wissen um die Folgen von Ausgrenzung und Zwangsmigration. Deshalb sollte die Stadt Gifhorn die Bemühungen fortsetzen, die Opfer von nationalsozialistischer Diktatur und Rassismus aus dem vorherigen Vergessen zu entreißen. Zugleich sind diejenigen zu benennen, die den Nationalsozialismus auch hier vor Ort gefördert und ins Werk gesetzt haben.
Chronik: Das Ende des Zweiten Weltkriegs in und um Gifhorn im Jahr 1945
-
bis 10. April: Luftangriffe auf den Fliegerhorst in Wesendorf in drei Angriffswellen mit 82 Toten.
-
April: Bombardierung des Bahnhofs Gifhorn-Stadt und der umliegenden Oldaustraße durch einen Fliegerangriff, 18 Bomben fallen, 11 Menschen kommen ums Leben.
-
April: Die Alliierten erreichen den Landkreis Gifhorn. Am Bahnhof Meinersen-Ohof kommen 600 Häftlinge aus dem KZ-Außenlager Dora-Mittelbau an. Sie sind auf dem Todesmarsch nach Bergen-Belsen.
Die Gifhorner Schulen werden geschlossen.
- April: Verbrennung von Akten der Parteidienststelle auf dem Rathaushof. NSDAP-Kreisleiter Ernst Lütge und der Gifhorner Volkssturmführer Lütgemann flüchten, der Reichsarbeitsdienst setzt sich ab.
Der Bahnhof Gifhorn-Isenbüttel wird bombardiert, dabei geht ein Munitionszug in Flammen auf.
Die Gifhorner Stadtverwaltung lässt Schilder mit „Hitlerstraße“ – dem heutigen Steinweg – entfernen.
Transporte mit Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern fahren durch die Stadt, davon werden hunderte Menschen in der Viehmarkthalle untergebracht, einige sterben an Erschöpfung.
Reste der deutschen Soldaten ziehen sich über die Lüneburger und Celler Straße zurück.
- April:
Einmarsch der US-Amerikaner in Gifhorn, Gamsen und Kästorf, 8 Personen kommen dabei ums Leben.
Besetzung des Gifhorner Postamtes durch amerikanische Nachrichtentruppen.Fünfstündiger Beschuss von Westerbeck durch das 47. US-Panzergrenadierbataillon mit 2 Toten und vielen Verletzten. 22 Gebäude werden zerstört und 59 beschädigt.
- April:
Einquartierung der amerikanischen Truppen, viele Gifhorner Bewohner müssen ihre Häuser räumen und bei Verwandten oder Bekannten unterkommen.
Berichte über Plünderungen, Diebstähle, Überfälle und Vergewaltigungen.
- April:
Einmarsch der US-Amerikaner in Wilsche.
Letzte Bombardierung Gifhorns mit zahlreichen Toten und Verletzten.
-
April: Ernennung von Wilhelm Thomas zum Gifhorner Polizeichef durch die US-Militärregierung.
-
April: Die Geschäfte in Gifhorn öffnen wieder für Zivilpersonen. Der Verkauf erfolgt weiterhin mit Lebensmittel- und Bezugsmarken.
-
April: Methylalkoholunglück mit mehr als 400 Toten am Bahnhof Gifhorn-Isenbüttel.
-
Mai:
Die Ausgehzeiten werden auf 5 Uhr morgens bis 21 Uhr abends festgesetzt. -
Mai: Ernennung von Wilhelm Thomas zum vorläufigen Landrat des Landkreises Gifhorn.
-
Mai, 13 Uhr: Die Stadt Gifhorn wird Teil der britischen Besatzungszone unter den kommandoführenden Besatzungsoffizieren Oberst Britten und Birt.
Mai / Juni: Schließung der Schulen in den Ortsteilen. Schulkinder werden am Vormittag zu Aufräumarbeiten auf öffentlichen Plätzen oder zum Sammeln von Heilkräutern und Beeren herangezogen. Überprüfung der Lehrer auf ihre politische Vergangenheit.
Beginn des Wiederaufbaus von Betrieben; Erlaubnisscheine für die Konservenfabrik, Molkerei, Glashütte, Erdölbetriebe, Torfwerke und 7 andere Betriebe werden erteilt.
-
September: Zulassung der Gründung von neuen Parteien auf Kreisebene.
-
September: Anordnung einer Zwangssammlung von Kleidern, Schuhen und Wäsche für die Heimatvertriebenen/Flüchtlinge aus dem Osten durch Landrat Wilhelm Thomas.
-
Oktober: Schulbeginn in Gamsen.
-
Oktober: Eingeschränkter Schulbeginn in den Gifhorner Schulen.
-
November: Offizielle Wiedereröffnung der Volks- und Mittelschule in Gifhorn.
-
Dezember: Besondere Beachtung erfährt der Landkreis Gifhorn durch die sehr frühe Durchführung der Wahl der Gemeindeausschüsse durch eine parteilose direkte Personenwahl.
-
Dezember: Verfassung und stehende Regeln der Gemeindeausschüsse im Kreise Gifhorn treten in Kraft.
Ausstellung bis 13. Juni:
„80 Jahre Kriegsende in Gifhorn“
Lesesaal der Stadtbücherei
Cardenap 1, Gifhorn
Di. – Fr. 10 bis 18 Uhr
Sa. 10 – 13 Uhr