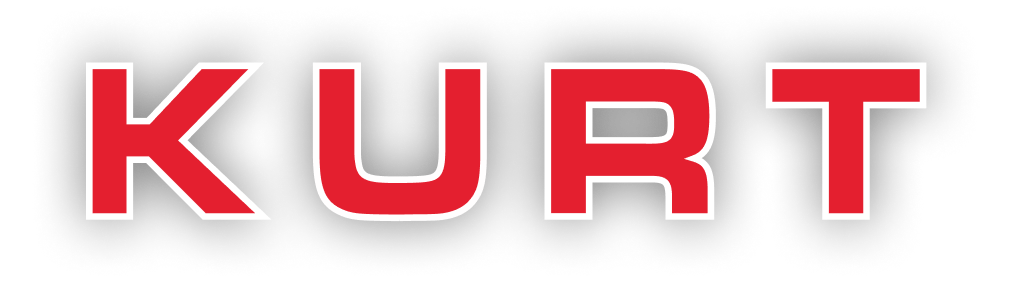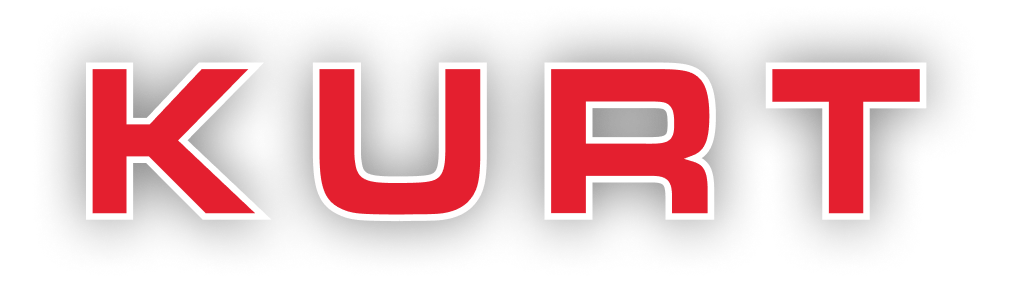Geschichte
Niemand darf vergessen werden - Neuausgabe von „Gifhorner Juden im Nationalsozialismus“ als kostenfreies E-Book
Manfred Grieger Veröffentlicht am 06.12.2020
Über Martha Schwannecke, 1905 geboren in Müden/Aller, liefert die erweiterte und überarbeitete Neuausgabe von „Gifhorner Juden im Nationalsozialismus“ neue Erkenntnisse.
Foto: privat
Als am 9. November 2018 die Erstauflage der Monographie „Gifhorner Juden im Nationalsozialismus“ veröffentlicht wurde, war das Interesse der Gifhorner Bevölkerung an diesem Thema groß. Nun, auf den Tag genau zwei Jahre später, erschien die zweite und um einige Erkenntnisse erweiterte Auflage. Dank einiger Unterlagen aus privater Hand und Hinweise aus den USA nahm sich Historiker Manfred Grieger des Buchs ein weiteres Mal an. In diesem Gastbeitrag für KURT gibt er Einblicke in die neuen Erkenntnisse.
Die nationalsozialistische Judenverfolgung auf kommunaler Ebene nachzuzeichnen, konfrontiert einerseits mit der schäbigen Alltäglichkeit von Diskriminierung, Beraubung und Judenmord. Andererseits treten Jüdinnen und Juden, die wegen nichts anderem als ihrer familiären Herkunft und angeblich unveränderlicher „Rassemerkmale“ als „jüdische Schmarotzer am deutschen Volkskörper“ benachteiligt, um ihren Besitz und ihr Glück oder sogar um ihr Leben gebracht wurden, endlich als Individuen hervor. Sie waren jünger oder älter, weiblich oder männlich, waren in Gifhorn bekannt oder lebten zurückgezogen als Nachbarn von „Volksgenossen“ und „Parteigenossen“. Manche überlebten, andere wurden in den Tod transportiert. Ihre Lebensgeschichten rühren an und machen das lange Schweigen der Gifhorner Stadtverwaltung, von Politik und Stadtgesellschaft umso beredter.
Das Buch über die im Nationalsozialismus verfolgten Gifhorner Jüdinnen und Juden fand nach der im November 2018 erfolgten Veröffentlichung in der neuen Schriftenreihe des Stadtarchivs Gifhorn interessierte Aufnahme. Die Erstauflage war nach recht kurzer Zeit vergriffen.
Nachdem eine Zuschrift aus den USA darauf aufmerksam gemacht hatte, dass in der Darstellung ihre Mutter, eine geborene Schwannecke, fehlte, lag der Handlungsbedarf auf der Hand: Niemand durfte vergessen werden, so dass die Studie schließlich auf der Basis von neu aufgetauchten Dokumenten wie Fotos oder Briefen aus privater Hand sowie zusätzlich herangezogene Unterlagen wie der Meldekartei der Stadt Gifhorn um zehn Seiten ergänzt wurde. Die Stadt Gifhorn entschied, die neuen Erkenntnisse in einem erweiterten Buch nunmehr in elektronischer Form der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Dieser Schritt zum Open Access (offener Zugang) erleichtert die Partizipation an der kommunalen Geschichtskultur und stellt zugleich eine weitere Modernisierung der Arbeit des Stadtarchivs dar.
Dank einiger neuer Unterlagen und des Kontakts zu zwei Töchtern von Martha Schwannecke konnte Historiker Manfred Grieger auch die jüdische Familiengeschichte von Gustav Schwannecke senior aufhellen.
Foto: privat

Was ist noch neu? Endlich enthält der überarbeitete Text Hinweise auf die älteste, am 20. Februar 1905 in Müden/Aller geborene Schwannecke-Tochter Martha Elisabeth Emma. Sie war musisch interessiert, absolvierte die Mittelschule und durchlief kaufmännische Privatschulen. Nach dem frühen Tod ihrer Mutter half sie im Textilgeschäft und Haushalt ihres Vaters Gustav Schwannecke, bevor sie 1934 den Obermüller Liedtke von der Cardenap-Mühle heiratete. Insbesondere nach der Einberufung ihres Ehemanns zum Militär hatte die Mutter von sechs Kindern nach den Erinnerungen ihrer ältesten Tochter große Angst, zusammen mit ihren Kindern „abgeholt“ zu werden. Dass ihre Tochter Ilse als jüdischer „Mischling II. Grades“ sogar vom Puppenspiel ausgeschlossen war, zeigt die offene Hartleibigkeit der lokalen NS-Diktatur.
Eine Reihe von Briefen, die die schließlich in Auschwitz ermordete Bertha Müller ihrem Sohn aus erster Ehe, dem Schlachter Erich Lehmann, 1942/43 vornehmlich aus der Untersuchungs- und Gefängnishaft schrieb, führt tief in die Gefühlslage einer durch das NS-Regime verfolgten Jüdin, die zwischen Hoffen und Bangen schwankte, in ihrer Großherzigkeit Nachbarn nach ihrer Verhaftung Mehl und andere Lebensmittel aushändigen ließ. Die neu hinzugezogenen Unterlagen geben aber auch einen Hinweis auf den Grund ihrer zunächst verbüßten Strafhaft. Ihr wurde „Unterlassung eines Antrages auf Ausstellung einer Kennkarte“, also ihres Personaldokuments, zur Last gelegt, ganz so als wollte die 65-Jährige ihre jüdische Identität verschweigen oder gar untertauchen. Da die Ortspolizeibehörde für die Ausstellung der Kennkarten zuständig war, gibt der Strafantrag einen erneuten Beleg für die antisemitische Praxis des damaligen Bürgermeisters Ludwig Kratz, der auch als Leiter der Ortspolizeibehörde fungierte.
Über Frieda Samuel wissen wir seither besser, dass sie als „Sternträgerin“ alltäglichen Diskriminierungen ausgesetzt war, etwa wenn sie auf dem Weg von der Torstraße zu ihrer Nichte in der Cardenap-Mühle von Hitlerjungen mit Steinen beworfen wurde. Indem die zurückgezogen lebende Frau in Gifhorn im August 1942 in einem Schreiben an die Ehefrau des Hermannsburger Pastors, Karin Harms, berichtete, dass ihre in Hamburg lebende 75-jährige Cousine am 15. Juli 1942 „noch fortgekommen“, also deportiert worden sei, straft sie diejenigen Lügen, die wie die Mehrheit der Gifhorner Bevölkerung in der Nachkriegszeit behaupteten, von alldem nichts wahrgenommen und gewusst zu haben. Nicht Vergessen oder Verdrängen, sondern das bewusste Verschweigen oder die Leugnung deren Verhalten.
Wenn es gelingen könnte, zur Erinnerung an die Menschen, die die Nationalsozialisten als Juden oder mit anderen Scheinlegitimationen verfolgt haben, im Stadtgebiet Stolpersteine zu setzen, bliebe deren Leidensweg nicht nur zwischen zwei Buchdeckeln, sondern fände ins öffentliche Bewusstsein.
Das kostenfreie E-Book zur Neuauflage von Manfred Griegers „Gifhorner Juden im Nationalsozialismus“:
www.stadt-gifhorn.de/sv_gifhorn/Lebenswert/Stadtarchiv/Publikationen/