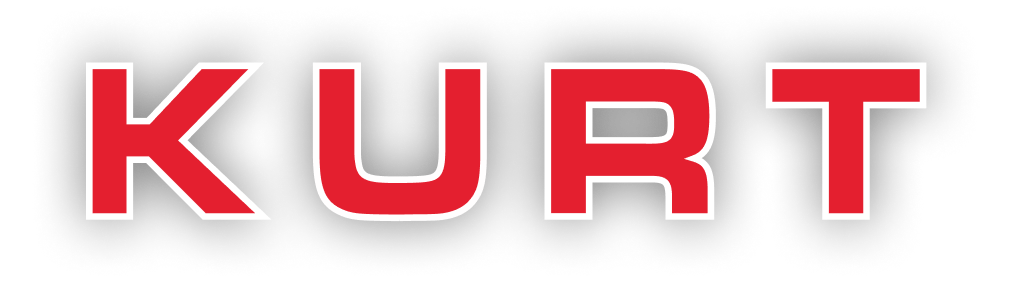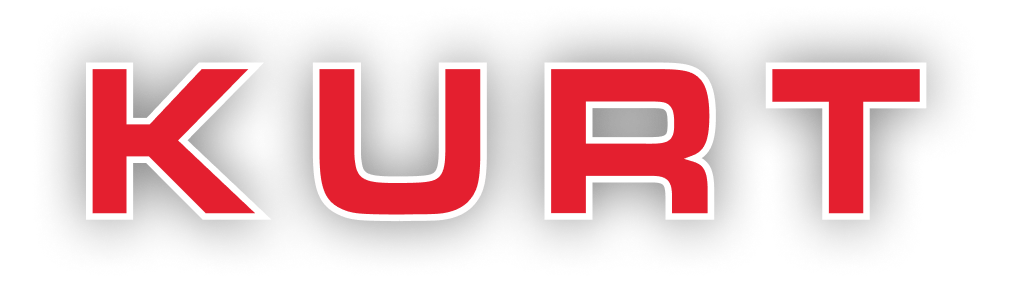Glauben & Zweifeln
Heimat in entgrenzter Zeit - KURT-Kolumnist Martin Wrasmann über einen Bienenstich, mit dem etwas nicht stimmte
Martin Wrasmann Veröffentlicht am 11.12.2021
In der Museumswohnung Emma in Gifhorn erinnert Martin Wrasmann sich – an die Kaffeetafel im Hause der Großmutter, und was damals alles ungesagt blieb.
Foto: Michael Uhmeyer
Manche Themen kommen so daher, mit Unschuldsvermutung, erweisen sich aber als biographisch belastet. So geht es mir heute: Heimat in entgrenzter Zeit. Wir gedenken besonders im November der Opfer der Kriege und nennen sie Gefallene, Heimatvertriebene… Uns kommen dabei auch die Täter in den Sinn, wir nennen sie nicht Mörder, eher Kriegsverbrecher. Und wir denken an Verlust, zuerst der vielen Toten auf allen Seiten, besonders aber des jüdischen Volkes und dem Verlust von Heimat. Und wir verdrängen Begriffe, solche wie Heimat und Herkunft, Nation und Identität. Da braucht es Orientierung, eine schlage ich an dieser Stelle gerne vor.
Eine Kaffeetafel im Hause der Großmutter: Die Tassen mit Goldrand, der Kaffee dünn, für die Kinder Caro-Kaffee. Bienenstich, an den höchsten Feiertagen auch gerne gefüllt. Am Tisch herrscht Ordnung. Bloß nicht nach einem zweiten Stück fragen: „Du Lorbas!“ Über uns ein Ölgemälde – die Ostsee am Kurischen Haff, dunkel-aufgewühlt. Und zwei Fetzen aus all den Gesprächen ragen heraus. Sie bleiben für mich ein Leben lang, und wo sie nicht geblieben sind, sind sie doch bestimmend geblieben: „Nicht wieder vom Krieg anfangen!“ Und: „Hiesiger oder Vertriebener?“ Was denn wohl aus dem Franz aus Heiligenbeil geworden sei? Ach Gott, der Kessel von Heiligenbeil und der Ortsbauernführer und die Gräfin Finckenstein... „Aber nicht wieder vom Krieg anfangen.“
Danach waren einige Sekunden Schweigen, ein Loch. Und ich dachte mir: Irgendetwas Schlimmes musste passiert sein – und niemand durfte darüber reden. Mit dem Bienenstich stimmte etwas nicht.
Der Onkel hätte in der Stadt einen sehr netten Herrn kennengelernt, mit guter Stellung auf dem Amt; sehr gesprächig und ganz hinter dem Adenauer. Und dann: „Ja, aber – ein Hiesiger oder ein Vertriebener?“ So war das also: Es gab solche und solche, Leute von hier und Leute von dort. Wo war dort eigentlich? Die einen hatten Heimat, die anderen nicht. Die, die keine Heimat hatten, mussten zusammenhalten, eine Schicksalsgemeinschaft. Deshalb kaufte man nicht bei Hiesigen, sondern bei Vertriebenen ein. Vertriebener, das war kein Faktum, das war ein Wort mit Geltungsanspruch. „Nicht wieder vom Krieg anfangen – Hiesiger oder Vertriebener“, es bestimmte die ganze Kindheit.
Hans Paukstadt: „Sarkau am Kurischen Haff“, Gemälde vor 1944.
Foto: Hans Paukstadt (Gemälde)
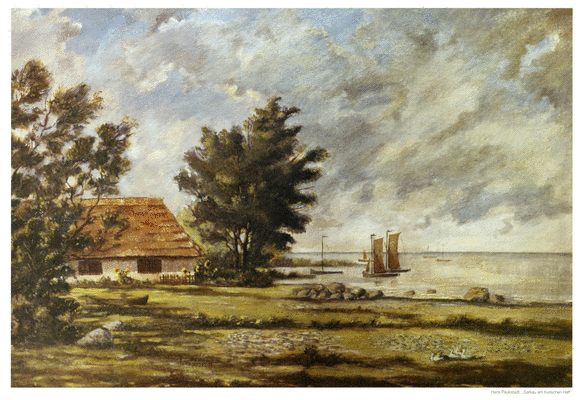
Ich bekam ein Schönschreibheft. Auf dem Weg zur Schule war ein Haus mit Löchern in der Fassade, wohl eine MG-Salve. Was das denn sei, mit den Löchern da? Das sei von früher, das wird noch weggemacht. Und wieder diese Sekunden Schweigen. Nicht wieder vom Krieg anfangen.
Weiter draußen waren die großen englischen Kasernen. Da lebten die Tommys. Wir gehörten also zur britischen Zone. Das war nicht so gut wie die amerikanische Zone, aber bei den Tommys gab es ein schottisches Garderegiment: immerhin. Ob denn die Deutschen auch so große Kasernen in England hätten? Wieder dieses Schweigen. Irgendetwas Schlimmes musste passiert sein.
An den Weihnachtstagen stellten wir Kerzen ins Fenster: „Für die Brüder und Schwestern im Osten.“ Was denn mit denen sei? Die Russen sind da und der Spitzbart. Überhaupt: die Russen! Wieder dieses Schweigen, was war mit dem Bienenstich?
Ich habe die Kindheitsfragen in die Jugend weitergeschleppt. In der Untersekunda schrieb ich mein allererstes Referat. Über den 20. Juli 1944. Zu Hause begann ich in der Zeit, da ich handwerklich unbegabt war, Thesen aufzustellen. Ich hatte auch gelesen, dass Erziehung ein dialektischer Prozess sei. Deshalb mit Manneskraft: Dass es eigentlich gut gewesen wäre, wenn Carl Goerdeler, ein Vorbild, erster Bundespräsident geworden wäre, teilte ich mit. „Nicht wieder vom Krieg anfangen.“
Und später nach dem Abitur ging ich weg aus dem Emsland, ich wollte doch auch einmal Heimat haben. Aber es blieb so: Etwas stimmte mit dem Bienenstich nicht. Irgendwann war ich überzeugt: Man konnte Heimat haben, ja, vielleicht in Illinois oder Delaware, in der Gascogne oder in Sussex – aber wir? Wir hatten alles verspielt. Wir kamen aus einem Land ohne Heimat. Das Wort war beschädigt.
Und in der Tat ist der Begriff Heimat einer der virulentesten und prekärsten der politischen und Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik nach dem Krieg. Der Begriff wurde zunächst abgedrängt und fand bei den Vertriebenenverbänden gleichsam ein Reservat, er wurde in Verbindung mit Revanchismus negativ ideologisch aufgeladen und er wurde moralisch sanktioniert: Wer Heimat sagte, wollte Schuld verdrängen. Mistland. So ist der Status aller großen gesellschaftlichen und kulturellen Leitbegriffe in Deutschland bis heute: Nation, Identität, Volk, Leitkultur. Man kann in Deutschland eben den verfassungsrechtlichen Begriff der Judikative zumindest politisch nicht aufrufen, ohne nicht irgendwann aus verdämmernden Rändern der Erinnerung das Bild des schreienden Schandmauls Roland Freisler mit zu erinnern: „Sie sind ja ein schäbiger Lump!“ – Unsere Begriffe sind beschädigt.
Wir erfahren seit Generationen eine fortschreitende Individualisierung. Dies bedeutet Autonomie des Einzelnen, Selbstbestimmung und Auflösung traditioneller Bindungen, zugleich aber auch eine Atomisierung der Gesellschaft. Was verbindet uns Einzelne und was ist uns verbindlich?
Nun sind wir alle selbstbestimmt und zugleich allein. Und damit wächst die Angst: Wer zu den Verlierern gehört, ist in einer selbstbestimmten Gesellschaft noch mehr allein. Womöglich stören die Alten irgendwann die Selbstbestimmung der Jungen, es stört das Baby die Selbstbestimmung der Frau, es stört der behinderte Mensch die Selbstbestimmung des gesunden. Die Entgrenzung des Gemeinschaftlichen auf das Individuum hin ist Grundlage unserer Freiheitsgeschichte. Was aber ist, wenn damit grundlegende Humanitätsverpflichtungen aufgelöst werden?
Die Unruhe über diese Ambivalenzen von Entgrenzung, über diese Modernitätsfolgelasten wächst. Was ist denn, wenn unsere Fortschrittsrechnung doch nicht aufgeht? Das ist die Unruhe in den modernen Gesellschaften heute.
„Willkommen heißen kann nur, wer Heimat hat.“ Foto: Çağla Canıdar

Martin Wrasmann, katholischer Theologe aus Gifhorn
Diese Unruhe hat viele Gesichter: das der Regression in einer neuen Biedermeierlichkeit, das der Aggression der Fremdenfeindlichkeit und Homophobie, das der ästhetischen Religion – und eben der neuen Heimatlichkeit. Die grundlegende Frage hinter alldem lautet: Wie können wir das humane Erbe unserer Gesellschaft retten? Oder, mit Habermas:
Welche Ressourcen haben wir in einer entgleisenden Moderne? Und Heimat? Dieser Erinnerungsort in entgrenzter Zeit? Was soll das sein, ein Rückzug, weil wir von allem die Nase voll haben? Wird Breslau wieder zur Festung erklärt? Nicht eine Heimat, die nur etwas von sich selbst weiß, kann uns Heimat sein, sondern Heimat kann uns sein, was das Andere aufnimmt, am Fremden immer neu zum Eigenen kommt. Marcuse erfand dazu die überaus geglückte Formulierung: vom Eigensinn zum eigenen Sinn.
Insofern begreife ich Heimat als eigenen Sinn, nämlich als Erinnerungswort, der am anderen seiner selbst Maß und Gestalt nimmt. Also ein Ort, der sich nicht in einer abstrakten und chicen Heutigkeit verliert, sondern am anderen, auch an anderen Generationen erinnernd zu sich selbst kommt. Denn wir wissen: Jeder von uns geht auf Straßen, die er nicht selbst gebaut hat. Und abschließend: Es sind so viele Andere bei uns jetzt.
Wir brauchen nicht kosmopolitisch zu sein und auch nicht im großen Menschheitsgestus ihnen gegenübertreten. Willkommen heißen kann nur, wer Heimat hat. Wohin sollte dieses Willkommen sonst einladen? In die Einkaufspassage?
Und es wäre die traurigste Nachricht in weltweiter Migration. Wenn die Afghanen, die Syrer, die Afrikaner, die zu uns kommen, sagten: Komisches Land hier, die haben ein Land, aber selbst keine Heimat.
Etwas stimmt mit dem Bienenstich immer noch nicht.
Martin Wrasmann, katholischer Theologe aus Gifhorn, schreibt die monatliche KURT-Kolumne „Glauben & Zweifeln“. Beipflichtungen wie auch Widerworte sind stets willkommen. Leserbriefe gerne an redaktion@kurt-gifhorn.de.